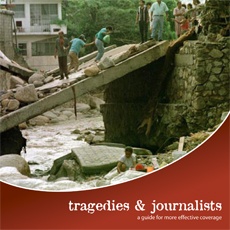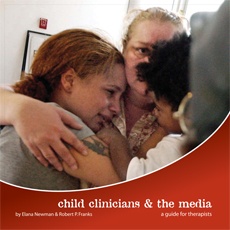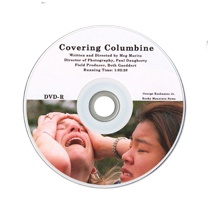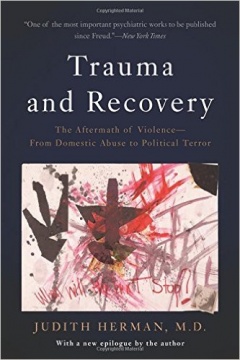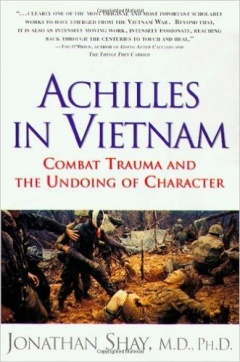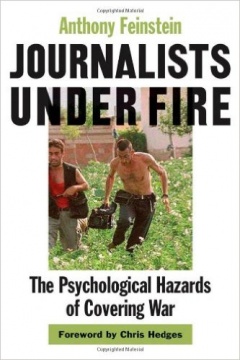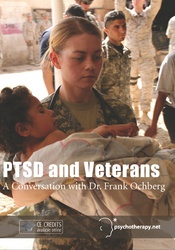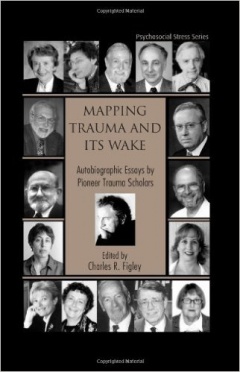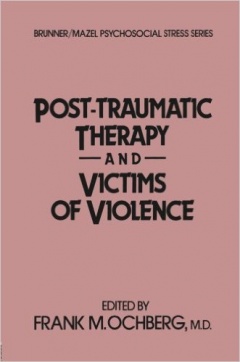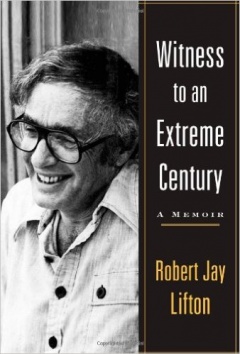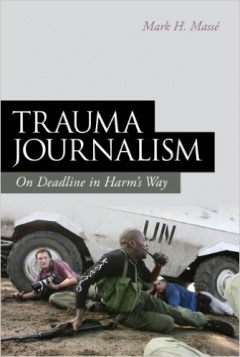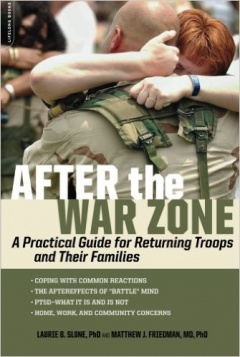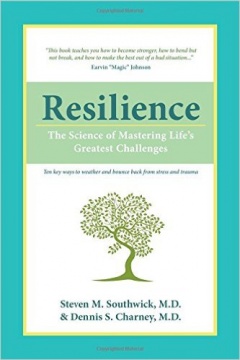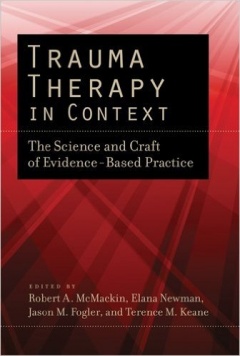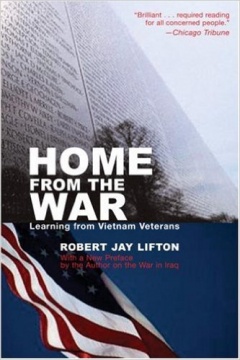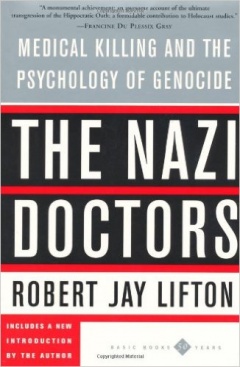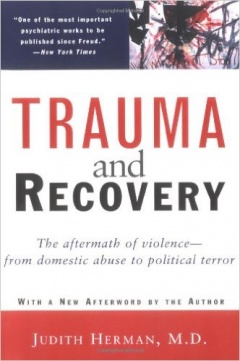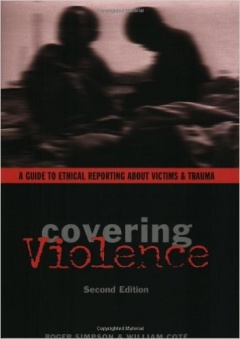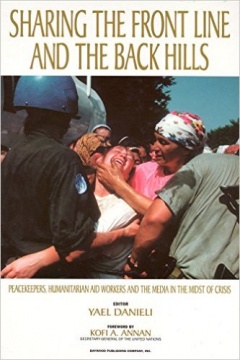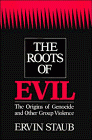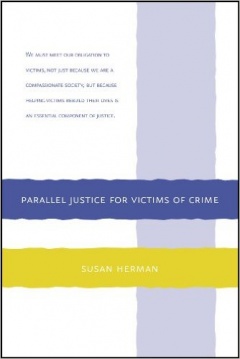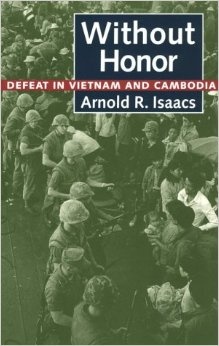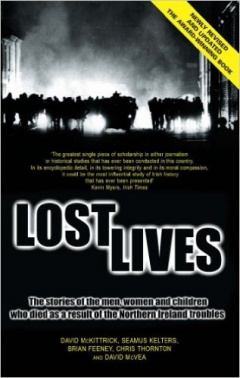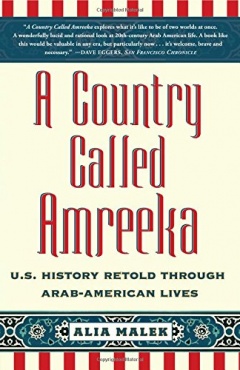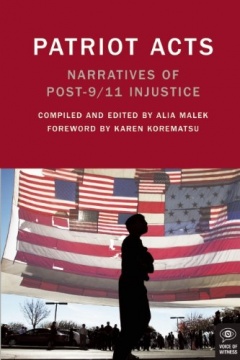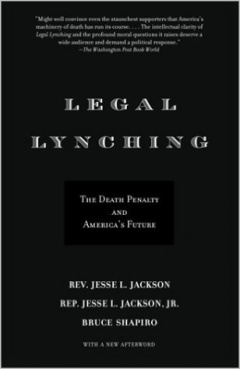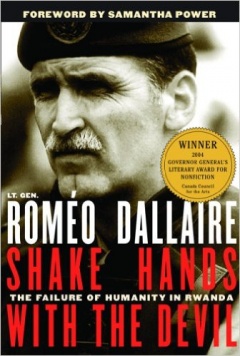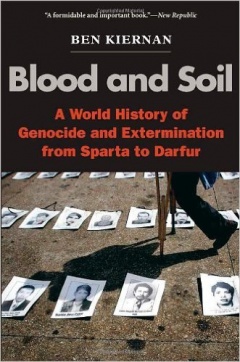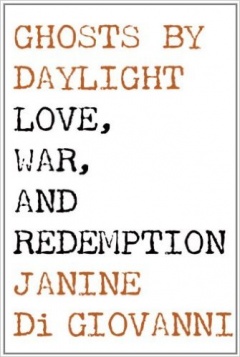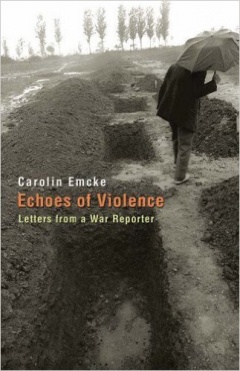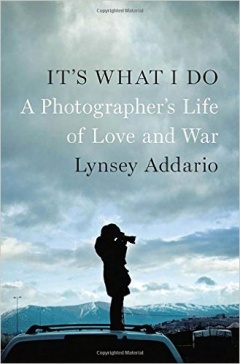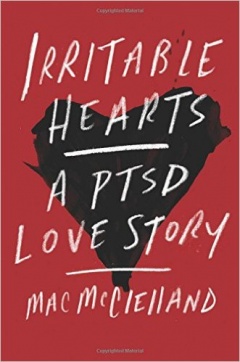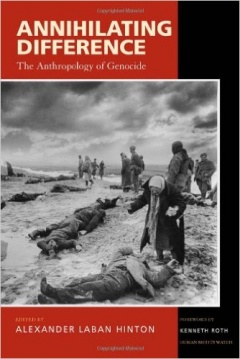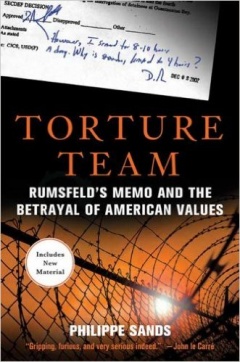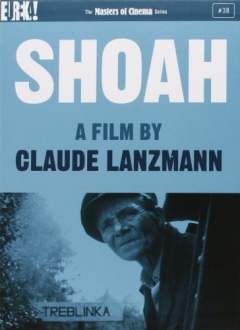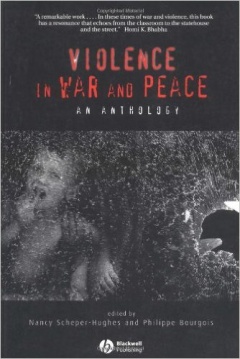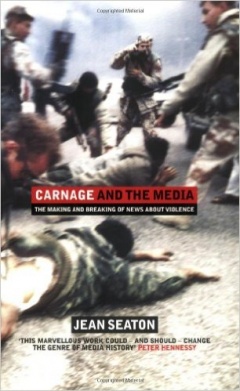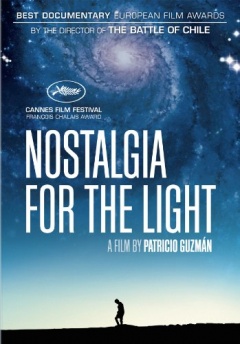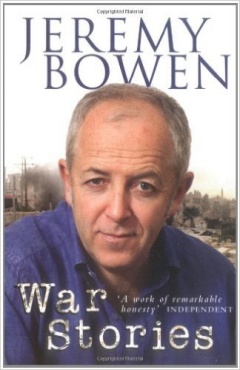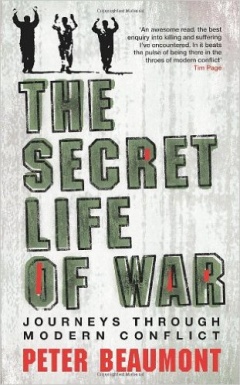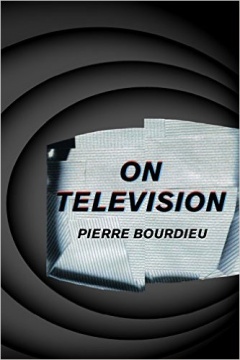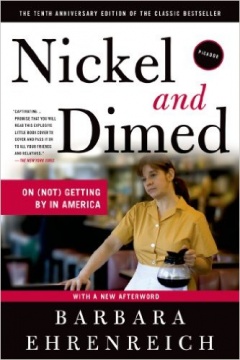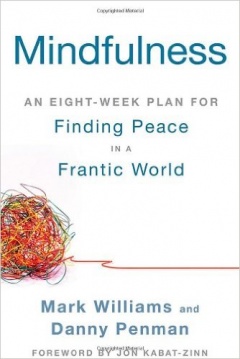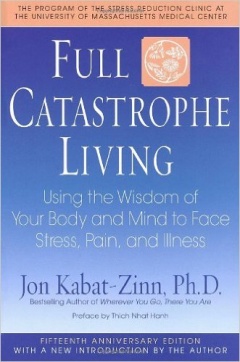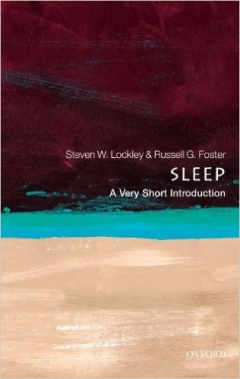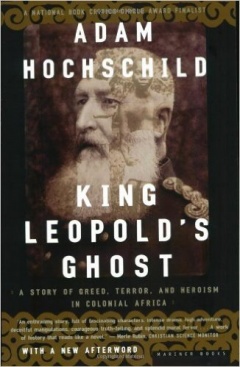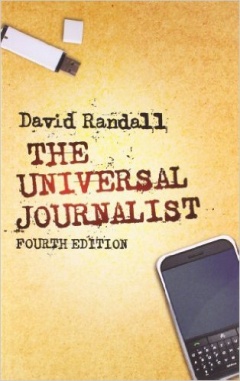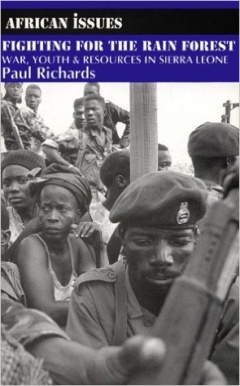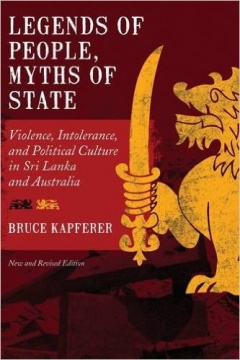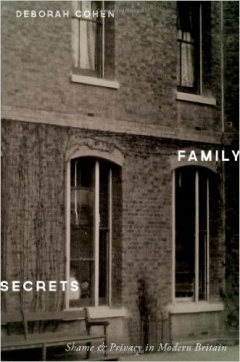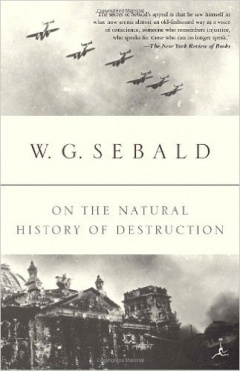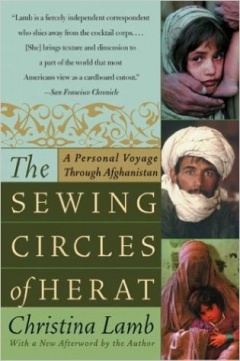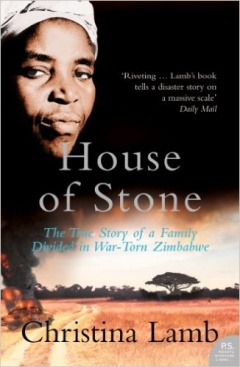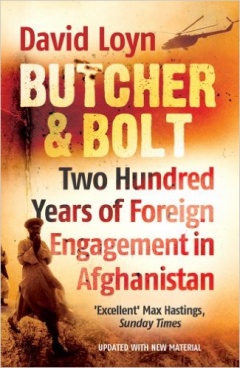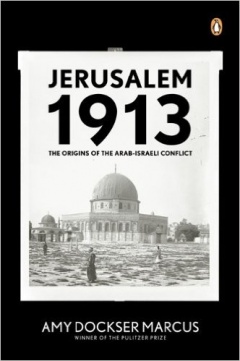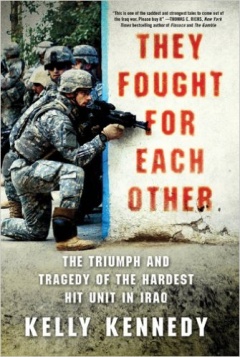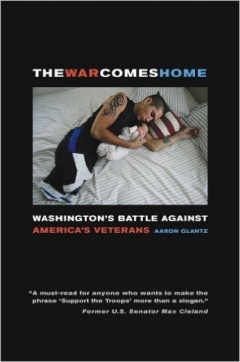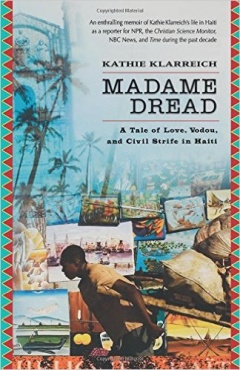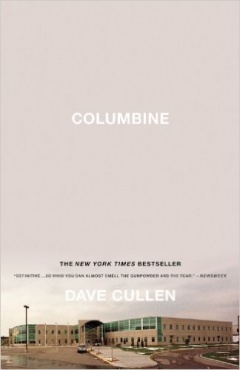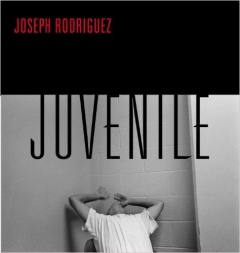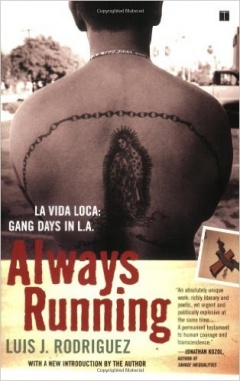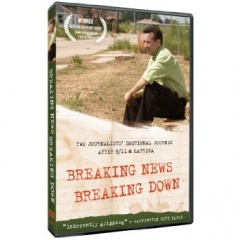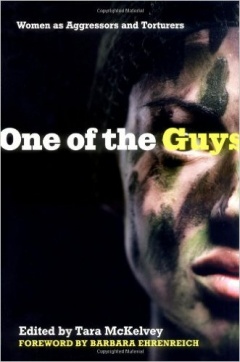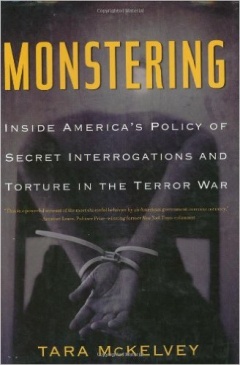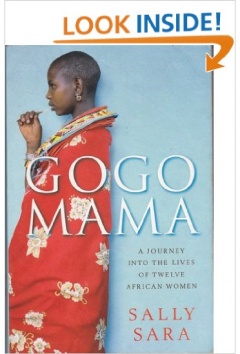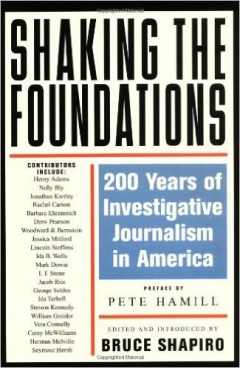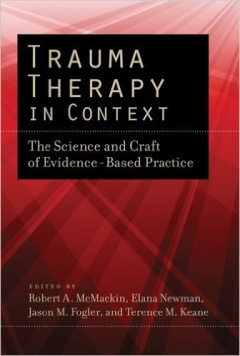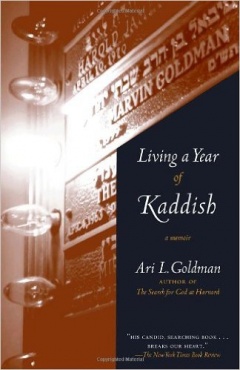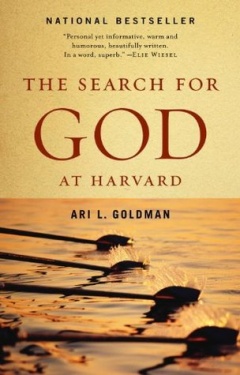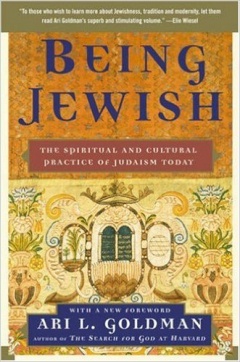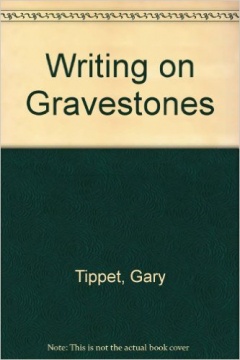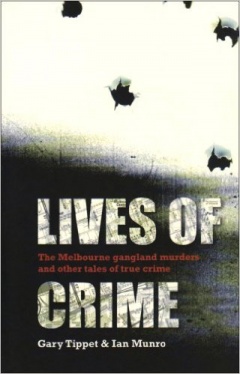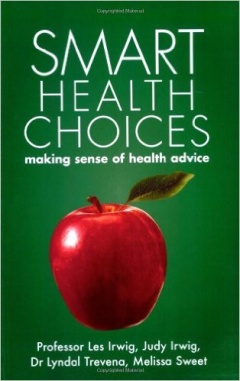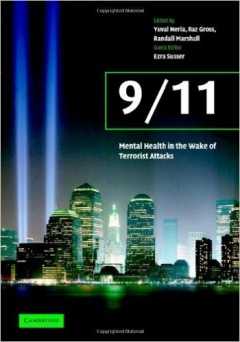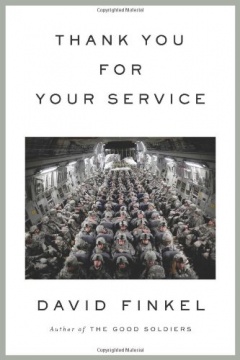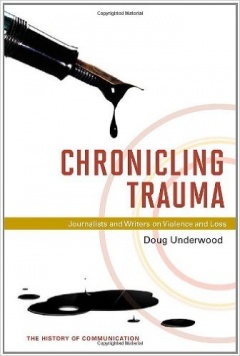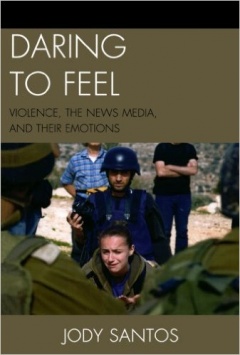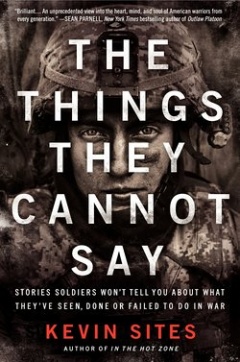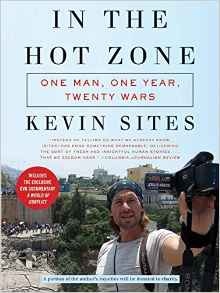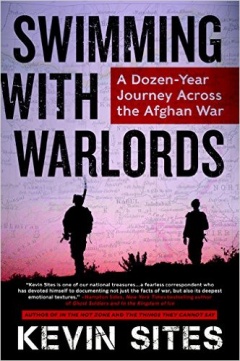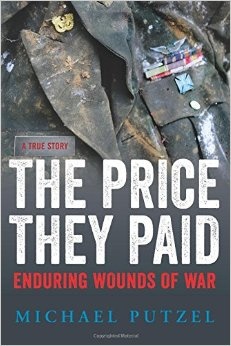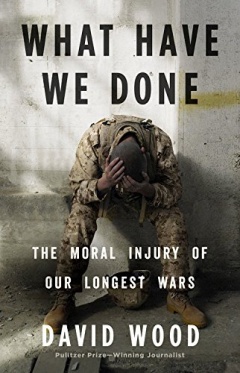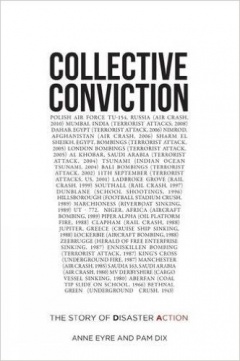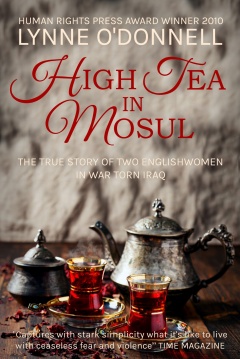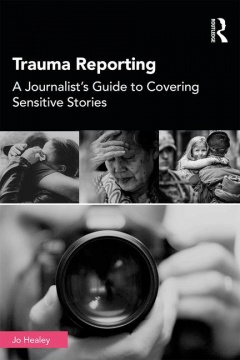Unverwundbar?
„Wir Journalisten sprechen gerne über alles, aber nicht so gerne und nicht so oft über uns“: Mit dieser Feststellung eröffnete Moderatorin Monika Hoegen vom Deutschen Journalisten-Verband (DJV) die Diskussionsveranstaltung „Journalismus und Trauma“.

Wie gehen Journalisten mit Traumata um? Während manche den Anblick von Blut und Desaster leicht wegstecken, verfolgt andere ihre Arbeit in immer wiederkehrenden Bildern des Schreckens bis in ihre Träume. Dass eine traumatische Reaktion individuell ist, zeigten die Erfahrungsberichte zweier Teilnehmer: Martin Hilbert war als freier Journalist und Filmemacher in Kriegsgebieten wie Ruanda und Afghanistan. Udo Beissel, Polizeireporter für den Erftkreis beim Kölner Stadtanzeiger, wird gerufen, wo immer sich ein Unfall ereignet hat.
Während Beissel konstatiert, er habe keine Probleme mit dem Anblick von Leichen, gibt es in Hilberts Erinnerungen Bilder, die ihm schwer zu schaffen machten. „Ich war in Ruanda zur Zeit des Genozids. Ich hatte mich vorgebildet und wusste, was mich erwartet: die Bilder von Toten und die Umstände, unter denen ich sie auffinden würde.“ Hilbert hielt sich für vorbereitet – doch es gab etwas, womit er nicht gerechnet hatte.
„Was mich umgehauen hat, waren die kleinen Kinder, die überlebt haben.“
Kinder, die mit großen Augen verängstigt aus ihren Verstecken hervorlugten. Die seine Nähe suchten. Denen er zu hunderten, zu tausenden begegnete. Hilbert vergaß, dass ein Journalist nur Beobachter sein darf. Da war nur noch ein Gedanke: Er wollte die Kinder dort herausholen, um jeden Preis. „Mein Rollenverständnis geriet ins Schwimmen.“ Der Familienvater konnte die Kinder nicht mitnehmen. Aber sie blieben trotzdem bei ihm. „Mich hat das über Jahre verfolgt. Jahrelang bin ich nachts aufgewacht, und ich hatte nicht Tote, ich hatte die Kinder vor Augen. Doch ich habe mich persönlich nicht traumatisiert gefühlt.“
Das wirft die Frage auf, was ein Trauma eigentlich ist. Dazu erklärt die Diplompsychologin Dr. phil. Christiane Eichenberg: „Auf der einen Seite gibt es eine bedrohliche Situation. Auf der anderen Seite steht eine Person mit individuellen Bewältigungsmöglichkeiten. Werden die überschritten, entsteht ein Trauma.“ Die Folge ist ein totaler Verlust des Sicherheitsgefühls:
„Man ist in den Grundfesten erschüttert. Das Urvertrauen, der Glaube an die Berechenbarkeit der Welt ist erschüttert.“
Und dann? Die Frage, ob es eine speziell auf Journalisten zugeschnittene Therapieform gebe, verneint Eichenberg. „Ich würde eine klassische Traumatherapie durchführen.“ Doch greifen solche vorhandenen Angebote? Moderatorin Hoegen stellt die provozierende Frage, ob jemand, der Afghanistan nicht erlebt habe, einem dort Traumatisierten denn helfen könne. Martin Hilbert gibt zurück: „Journalistisch gesehen bin ich ja ergebnisoffen“, was ihm einige Lacher beschert. Doch dann lenkt er ein: „Persönlich wäre ich etwas skeptisch, wenn da ein gewisser Hintergrund fehlt.“ Und auch wenn Eichenberg einwirft, um als Psychologe einem Menschen zu helfen, müsse man zum Glück nicht alles erlebt haben, was diesen aus der Bahn geworfen habe, bleibt Hilbert dabei:
„Ich glaube, dass ich das Gespräch mit einem Kollegen bevorzugen würde, der das Gleiche oder Ähnliches erlebt hat.“
Dass er mit dieser Bewältigungsmethode nicht allein ist, zeigt sich auch in einer Filmproduktion des Westdeutschen Rundfunks (WDR) von Thomas Görger, mit der dieser einen ersten Schritt zur Sensibilisierung seiner Angestellten machte. Darin berichten Medienmacher von ihren traumatischen Erlebnissen, und darunter sind auch solche, die das anschließende Gespräch mit dem Team – Kameramann, Cutter, Fotograf – als besonders hilfreich einstufen.
Anne Lührs, stellvertretende Leiterin der Aus- und Fortbildung beim WDR, begrüßt das. Sie ist eine von denen, die schon länger daran arbeiten, psychische Probleme im Beruf zu ent-tabuisieren. „Ganz am Anfang war es ein großes Problem, Akzeptanz zu finden“, berichtet sie. Den Film habe man noch bewusst ausweichend betitelt, um nicht das Wort „Trauma“ verwenden zu müssen. Darin allerdings reden bekannte Journalisten und Journalistinnen Tacheles. Lührs bemerkt:
„Wir haben im Film bewusst prominente Kollegen gezeigt, um deutlich zu sagen: Es ist nicht uncool, solche Schwierigkeiten zuzugeben!“
Auch Fee Rojas, Journalistin und Traumatherapeutin, betont:
„Man muss sich vor allem klar machen, dass es normal ist. Es ist eine normale Reaktion auf eine unnormale Situation.“
Das Erzählen ist ihrer Auffassung nach ein wichtiger Schritt, um das Thema zu verarbeiten. „Das ist etwas ganz Wesentliches, Narrativa zu erzeugen“, so Rojas, „die Geschichte irgendwie zu erzählen. Das ist auch das, was man in der Traumatherapie macht.“ In dieser Hinsicht habe sich nach Lührs’ Aussage bei ihrem Sender bereits einiges getan. „Man kann offener darüber sprechen“, erklärt sie. Die Hilfsangebote des WDR reichen nach Überzeugung der Redakteurin bereits so weit, dass niemand mehr mit Traumafolgen oder auch Suchtproblemen alleingelassen werde. Thomas Görger, Autor des Films, fügt bestätigend hinzu, dass sich das auch auf den Umgang der Kollegen miteinander auswirke:
„Wir merken, dass sich innerhalb des Kollegenkreises die Kultur der Nachbereitung verändert hat. Da ist viel mehr die Bereitschaft und auch der Wunsch vorhanden, sich auszutauschen.“
Weitgehend einig sind sich jedoch alle, dass das Hauptaugenmerk nicht auf die Nachsorge, sondern auf Vorbeugung gelegt werden müsse. Bereits in der Ausbildung müssen angehende Journalisten für das Thema Traumatisierung sensibilisiert werden. Jedoch: „Das darf nicht alles bleiben“, betont Lührs. „Das Thema muss auch später nochmals aufgegriffen werden.“ Zudem müsse die Vorsorge auch das Publikum mit einschließen, bei dem ebenfalls die Gefahr bestehe, dass es durch die gezeigten Bilder eine Sekundärtraumatisierung erleide.
Das berührt offensichtlich einen Nerv im Auditorium der Diskussionsrunde: „Wir wissen von der Gefahr der Traumatisierung mittelbar Betroffener, doch die Bilder, die wir zeigen, werden immer blutiger – müssen wir uns da nicht Gedanken machen, ob etwas falsch läuft?“, drückt es einer aus, und mehrere andere Wortmeldungen zeigen den gleichen Tenor. Strittig bleibt jedoch, inwieweit das möglich ist – denn die für Nachrichtensendungen verantwortlichen Redakteure fordern von den Reportern in der Regel spektakuläre Bilder.
Am Ende muss jeder Journalist seinen eigenen Weg finden. Krisenreporter Hilbert fasst das Dilemma zusammen:
„Der Grundkonflikt ist, dass wir als Journalisten in Situationen kommen, die so offen wie nur möglich sein sollen. Das steht im Widerspruch zur Traumavermeidung, die fordert, dass Situationen so berechenbar wie möglich sind.“
Und so versuche er immer im Voraus zu überlegen, worin beim nächsten Dreh seine „Ruandasituation“ bestehen könnte. Damals war es die Vernunft, die ihn irgendwann wieder auf den Boden geholt hat. „Ich habe alle möglichen Menschen gebeten, mir dabei zu helfen, die Kinder aus dem Land zu bringen – wenn nötig sogar illegal. Sie haben mir immer wieder erklärt, warum das nicht möglich sei. Und irgendwann habe ich verstanden, dass es einfach nicht sinnvoll gewesen wäre. Für die Kinder wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, auch noch aus ihrer Kultur und Umgebung herausgeholt zu werden.“ So muss er allerdings mit dem Wissen leben, dass eben jene kleinen, verschreckten Kriegsopfer aus Ruanda mit einiger Wahrscheinlichkeit heute als Kindersoldaten im Nachbarland Kongo morden.
Wie hat jemand wie Hilbert es geschafft, trotz all dieser Erlebnisse Journalist zu bleiben? „Man kann die Widersprüche aushalten, ohne dass man zum Zyniker wird“, bekräftigt er. Sein Kollege Beissel stimmt ihm zu. Der Polizeireporter betont, wie wichtig die Selbstfürsorge sei, auch in weniger dramatischen Situationen:
„Das wichtigste ist, dass man eine eigene Distanz aufbaut. Ich entscheide am Unfallort nach Gefühl, wie nah ich ran muss.“
Und auch für Hilbert gibt es klare Grenzen – Themen, die er strikt ablehnt: „Berichterstattung im Kongo mache ich nicht. Ich weiß, was das für Bilder wären, und das muss ich nicht mehr haben.“ Beissel fügt noch einen Satz hinzu, den man als Journalist vorbeugend im Hinterkopf behalten könnte: „Das ist man sich selbst auch schuldig.“
ZURÜCK zur vorherigen Seite