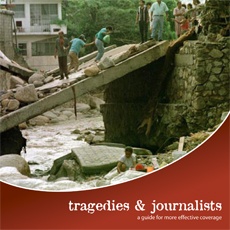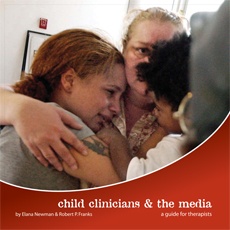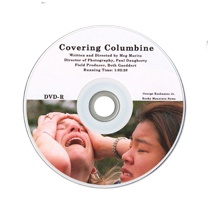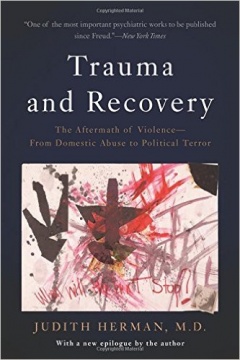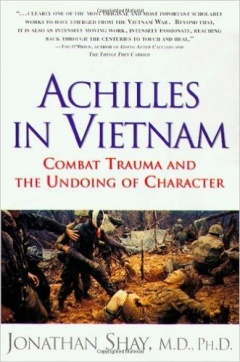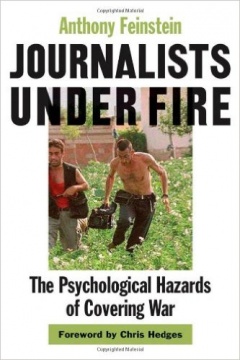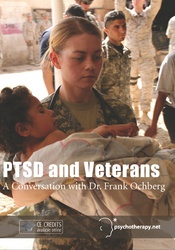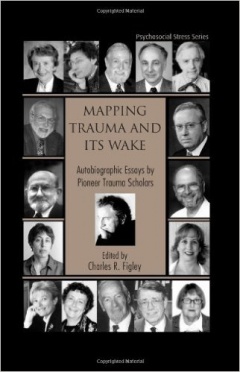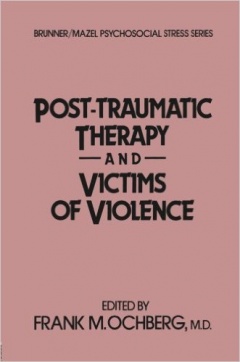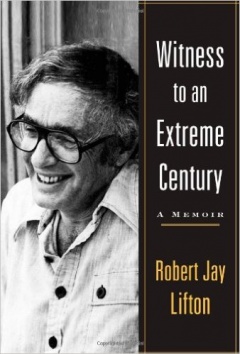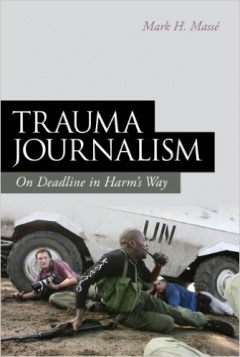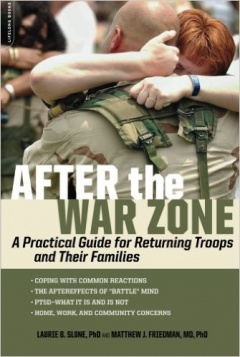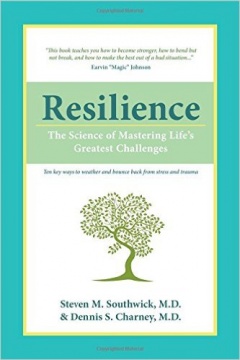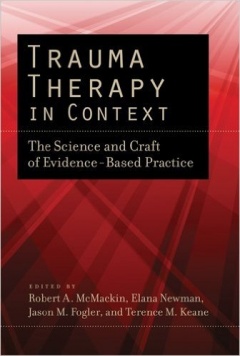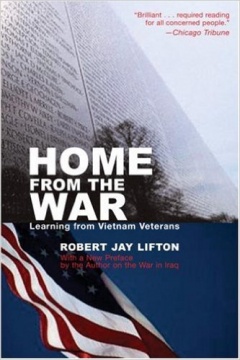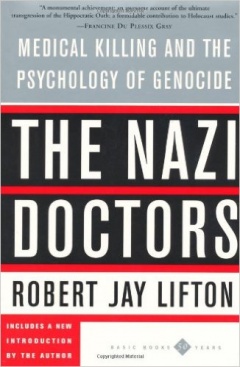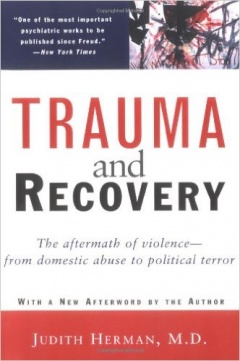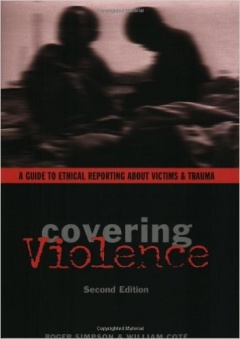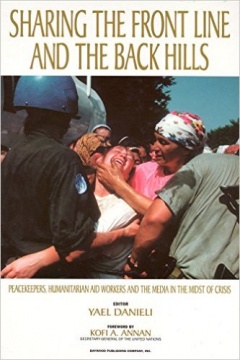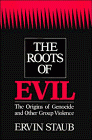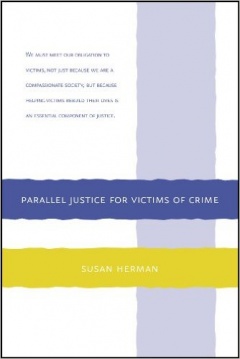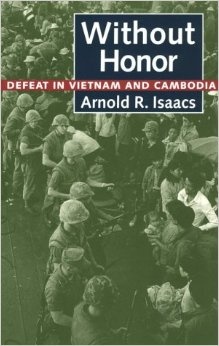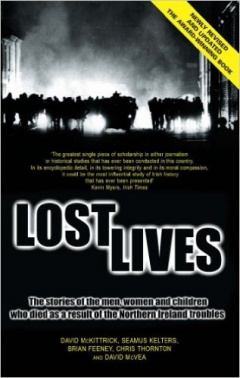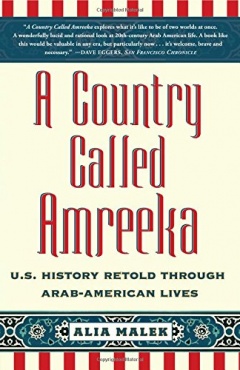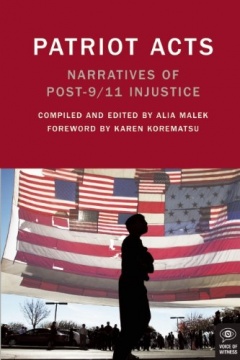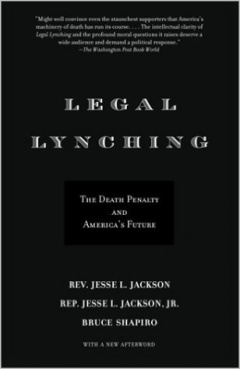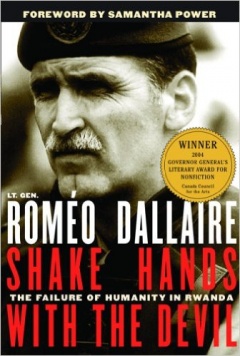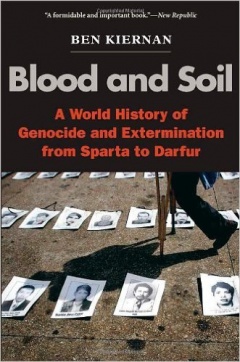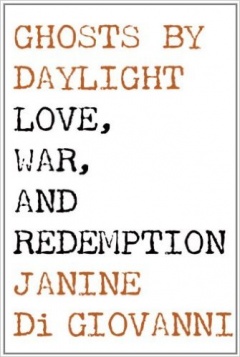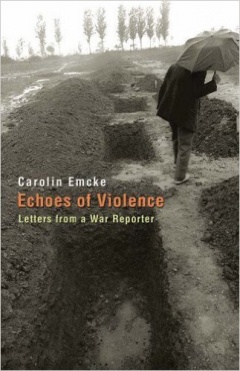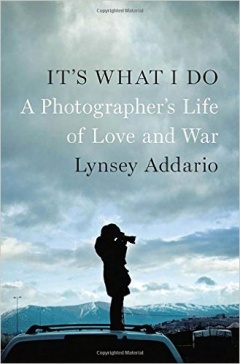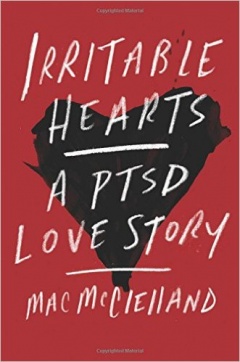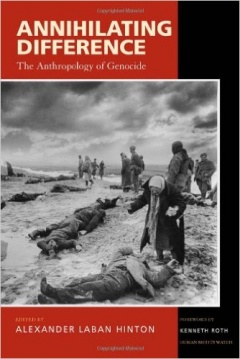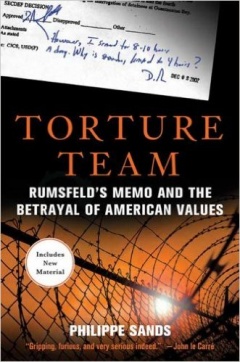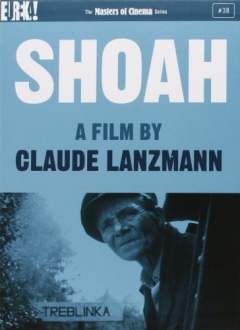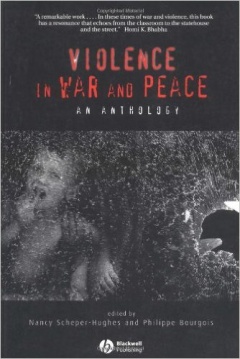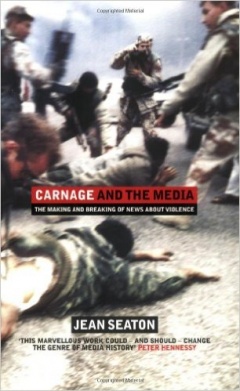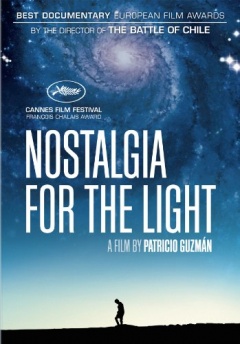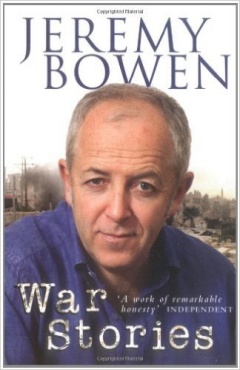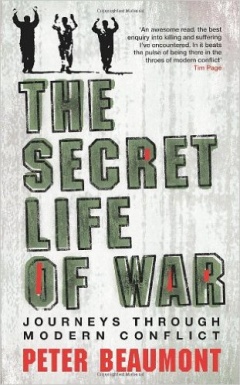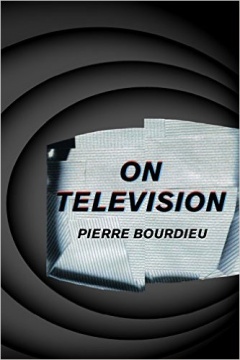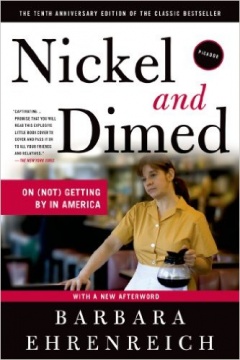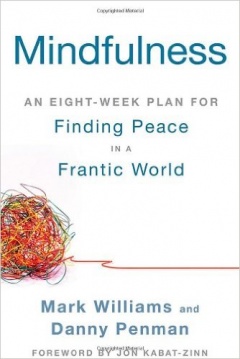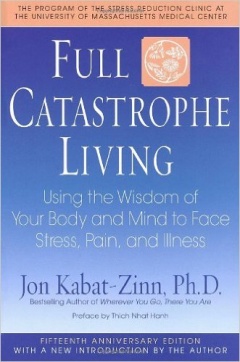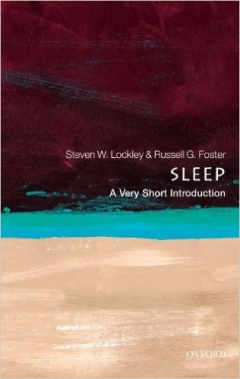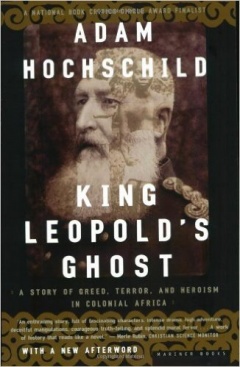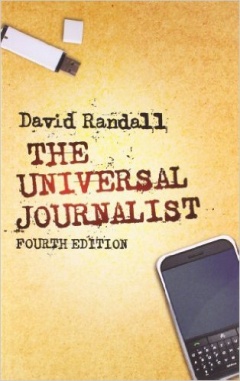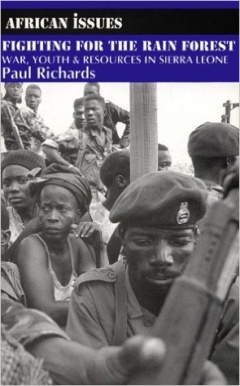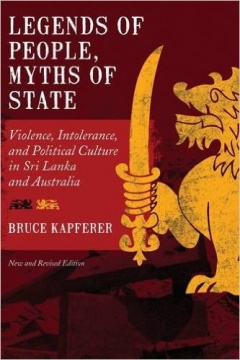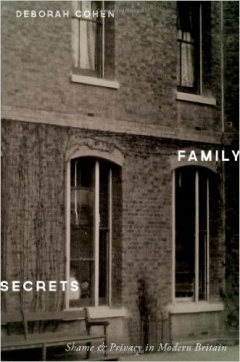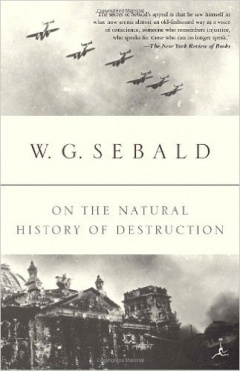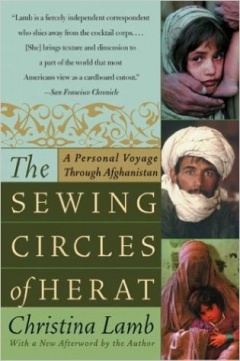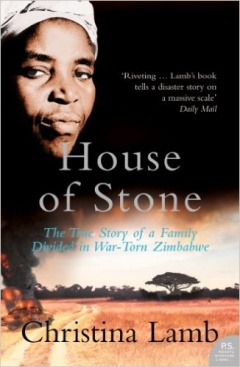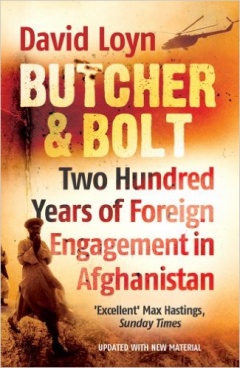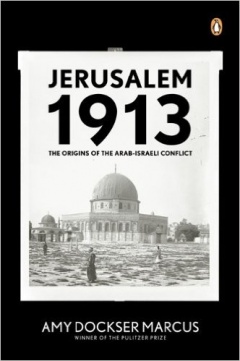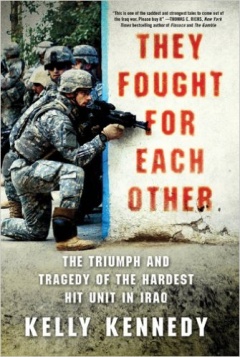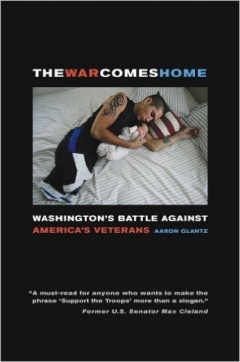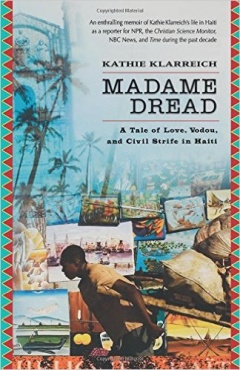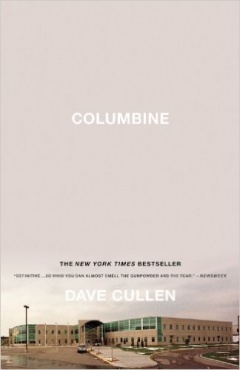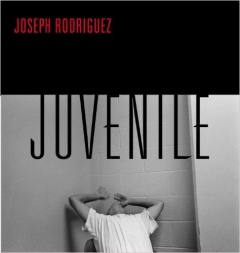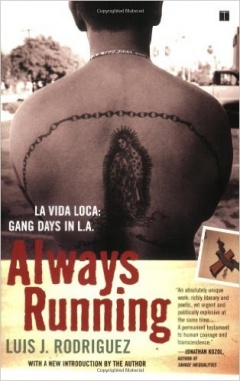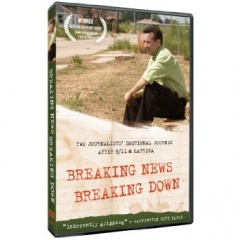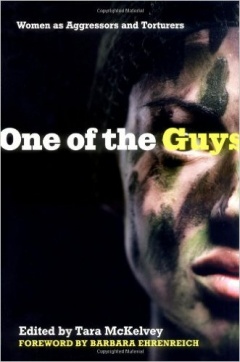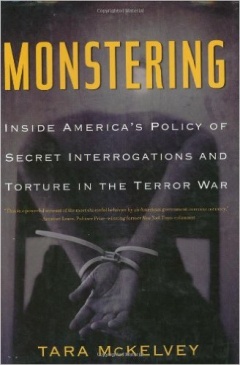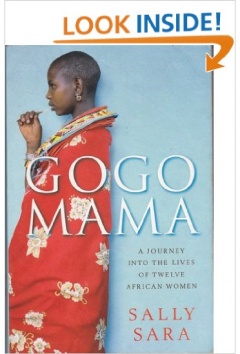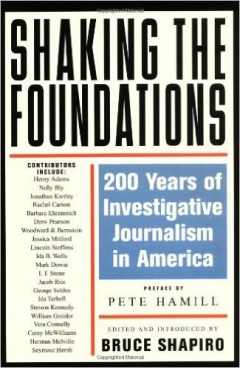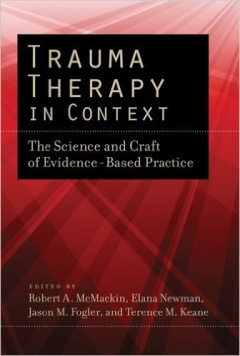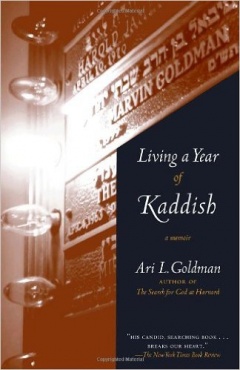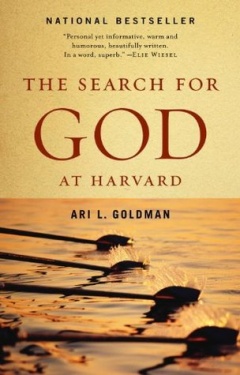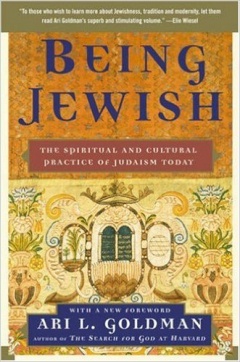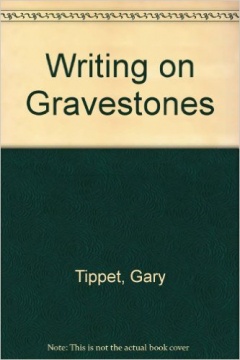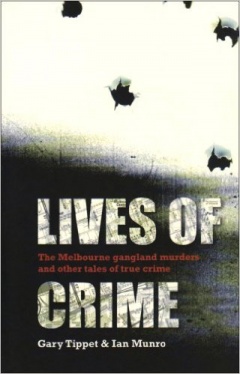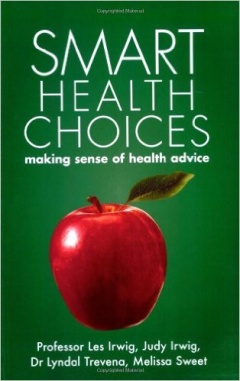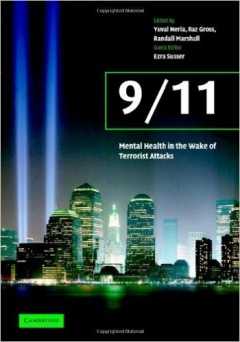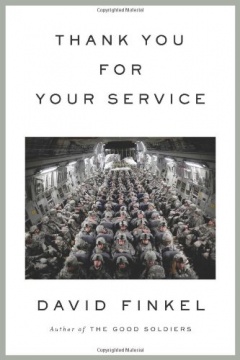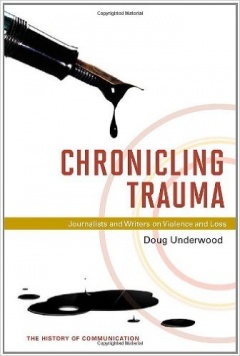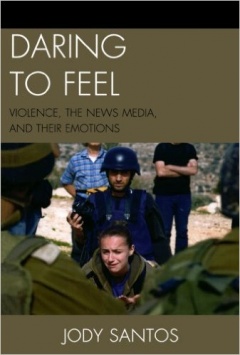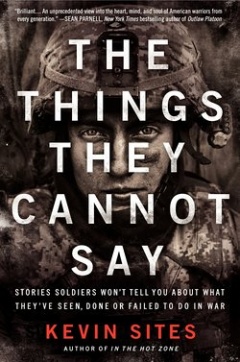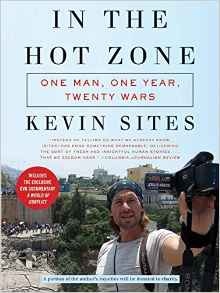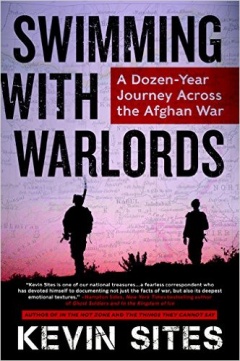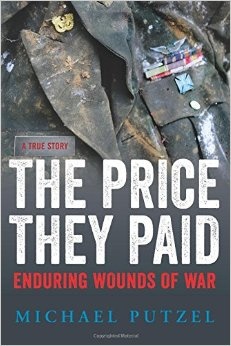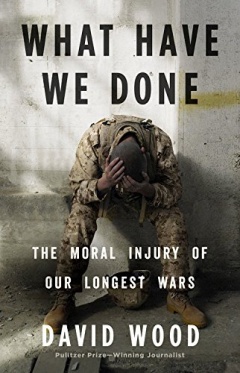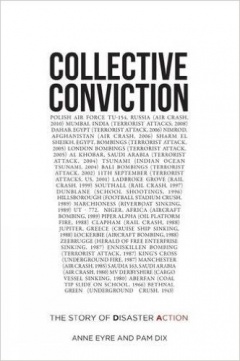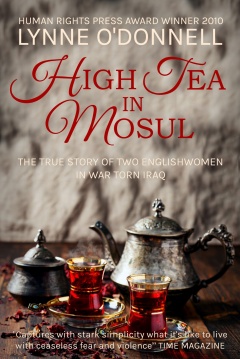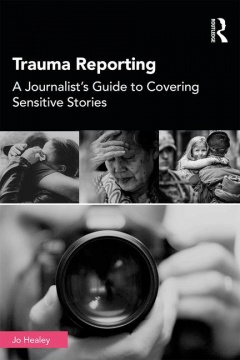Transparenz schaffen - Warum Medien auch hilfreich sein können
Katrin Hartig arbeitet seit vielen Jahren als Redaktionsleiterin beim MDR. Durch ihre persönliche Erfahrung im Umgang mit Schicksalsschlägen und im Bundesverband der Verwaisten Eltern tätig, berichtet sie hier von der Rolle der Medien sowie der Betroffenen und gibt Empfehlungen.
Bis zum Unfalltod meines Sohnes stand ich immer nur auf der „anderen Seite“ der Medien. Ich war seit 20 Jahren Fernsehjournalistin und traf als Chefin vom Dienst eines tagesaktuellen Fernsehmagazins ständig journalistische Entscheidungen. Als ich im März 2002 an den Unfallort gerufen wurde, standen dort in der ersten Reihe bereits mehrere Kamerateams und Journalisten. Diese waren, wie so oft in solchen Fällen, bereits vor den direkt Betroffenen informiert worden - während ich noch nicht ahnte, dass mein 13jähriger Sohn bei seinem ersten Wettkampf der Saison um sein Leben kämpfte und verlor. Fast ein Jahr haderte ich nach seinem Tod mit der Rückkehr in den Beruf.
Inzwischen leite ich wieder eine Redaktion. Gleichzeitig arbeite ich als Trauerbegleiterin und bin Vorstandmitglied des Bundesverbandes der Verwaisten Eltern und trauernden Geschwister Deutschlands. Ich bekomme in letzterer Funktion oft Medien-Anfragen, die an den Bundesverband gestellt werden. Manchmal, weil ein Prominenter sein Kind betrauert, weil gerade das Thema im Fokus steht, oder weil vor Weihnachten gerne ein paar emotionale Geschichten gesucht werden. Und es ist leider kein Einzelfall, wenn dann auch schon mal, z.B. von einer Produktionsfirma, die für einen privaten Sender arbeitet, Anfragen kommen wie: „Wir suchen eine emotionale Familie. Es sollen schon ein paar Tränen fließen. Andere Eltern brauchen wir nicht.“
Wir erleben Trauer und Tod nicht mehr im Leben. In den Medien schon. Wir haben meist keine Ahnung, was Trauer mit uns macht, wie sie uns verändert, was normal ist. Das macht unsicher.
Insofern sehe ich die Leistung der Medien ja auch darin, genau das, was nicht mehr erlebt wird, transparent zu machen. Viele Trauernde identifizieren sich mit solchen Filmen, weil sie so erfahren: Das, was ich fühle, denke, erlebe, das kennen andere auch. Ich bin nicht allein. Für meinen Film „Es war einfach nur ein Abgrund“, der in der ARD-Themenwoche zum Thema „Tod und Trauer“ lief, habe ich vier junge Menschen begleitet und sie befragt, warum sie bereit waren, über das Fernsehen in die Öffentlichkeit zu gehen.
- Karoline verlor ihre Schwester durch Suizid. Sie hatte auch schlechte Erfahrungen mit einem privaten Boulevardmagazin gemacht. Dennoch war sie einige Jahre danach bereit, in einem Film mitzuwirken, weil sie ihre Erfahrungen im Umgang mit Trauer teilen wollte: „Es ist erschreckend. Keiner will damit in Berührung kommen. Viele Menschen drehen sich schnell weg. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, über Bilder die Leute anzusprechen, und damit einen Bezug zu einem Menschen zu bekommen, der trauert. Auch junge Menschen trauern, denn auch bei Jugendlichen gibt es Verluste im Leben.“
- Anja verlor ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit ihren Mann durch einen plötzlichen Herztod: Was war ihre Motivation für Ihre Beteiligung an meinem Film? „Zum einen für mich, weil ich mich bewusst mit meiner Trauer um Wolfgang auseinandergesetzt habe. Und auch um anderen zu zeigen, es geht weiter.“
- Ulrike Straßheim ist Mutter eines ermordeten Mädchen aus Cuxhaven. Nach dem Mord an Levke entstanden längere Dokumentationen, zu denen sie sich bereit erklärte. Als die ersten Dreharbeiten begannen, wurde noch nach dem Täter gesucht. Nach der Ausstrahlung sagte sie: „Positiv war es nach dem Film, die Veränderung im Umfeld wahrzunehmen. Ich hatte ja die Sprachlosigkeit, die nach einem solchen Ereignis im eigenen Umfeld herrscht, thematisiert. Dass Menschen die Straßenseite wechselten, wenn sie uns sahen oder im Supermarkt einen anderen Gang wählen. Da hatte sich etwas verändert. Zwar schauten die Leute immer noch angsterfüllt, aus Sorge, etwas Falsches zu sagen, aber es war anders. Jetzt wusste ich, das war die Reaktion auf den Film. Und ich fand es gut. Ich hatte es ja ausgesprochen und die Menschen reagieren jetzt so. Ich hatte auch das Gefühl, dass eine Art Erleichterung da war, dass es ausgesprochen war.“
- Die Mutter eines durch einen LKW tödlich verunglückten Jungen hatte bereits mehrmals Erfahrungen gemacht im Umgang mit Medien anlässlich zum Gedenktag der verstorbenen Kinder in Deutschland. Sender suchten Betroffene und sie erklärte sich bereit, mitzuwirken. Über den Film, der damals entstand, sagte sie einige Zeit später: „Wenn ich Timmi, meinem jüngsten Sohn (er war knapp 3 Jahre, als sein Bruder verunglückte) den Film heute zeige, wenn er sieht, wie klein er war, wenn er das jetzt sieht - dann ist der Film auch ein kleines Geschenk. Ein Beleg meines Trauerprozesses.“
Eine der positivsten Funktionen des Journalismus aus Betroffenensicht: Das Aussprechen, was ist.
Und: Verwaiste Eltern gehen auch sehr selbstkritisch mit sich um. So sagte Dieter Steuer, damals Vertreter einer Gruppe Verwaister Eltern: „Wir verwaisten Eltern klagen immer wieder und darben darüber, dass das Thema Trauer in der Gesamtbevölkerung zu wenig wahrgenommen wird, dass sich Trauernde im Stich gelassen fühlen. Wir müssen selbst viel aktiver nach außen hin werden. Nicht schockieren, nicht konfrontieren, aber uns öffnen. Nur dann können wir auch auf das Verständnis hoffen.“
Können Hörfunk und Fernsehen genügend Orientierung und Rat bieten?
Für ein Reportageformat des MDR stellte der Sender einen Unfall nach. Zehn Jahre zuvor waren nach einem Diskothekbesuch zwei Jugendliche ums Leben gekommen, zwei überlebten. Thema der 9minütigen Reportage war es, über die extrem hohe Zahl an tödlichen Unfällen im Alter zwischen 19 und 24 Jahren zu berichten.
Erstmalig trafen sich die beiden Überlebenden vor Ort. Ich fragte sie nach ihrer Motivation und Erfahrung mit dem Drehteam. Sabine Meister sagte: „Ich habe durch die Auseinandersetzungen mein „Ich“ wiedergefunden. Und wenn einige Jugendliche durch den Film zum Nachdenken angeregt werden, war nicht alles umsonst, auch nicht der Tod von Andrè und Christian.“
In meiner Arbeit als Trauerbegleiterin erlebe ich in Workshops immer wieder sehr viel Unsicherheit im Umgang mit Medien - auch bei Sozialarbeitern, Hilfsorganisationen, Ersthelfern, Verbänden. Sie sind es, die ja oftmals den Journalisten auf Anfrage Betroffene vermitteln. Und: Gerade sie können gute Begleiter sein bei Interviews und Dreharbeiten. Vorausgesetzt, sie kennen ein paar Grundregeln des Umgangs mit Medien. Doch oft wird auf die Journalisten geschimpft und die Verantwortung ausschließlich auf diese abgeschoben.
Ein verantwortlicher Umgang mit Medien beginnt meiner Meinung nach bereits mit der Bearbeitung einer Anfrage und der Vorbereitung eines Betroffenen, ohne ihm jedoch seine Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu nehmen. Die Mittlerrolle wäre jedoch hilfreich für Journalisten wie Betroffene.
Checkliste für Betroffene vor einer Zusage zu einem Dreh:
• Was erwarte ich von den Medien? Was will ich erreichen? Was ist mein positives Ziel beim Auftritt? Das sollte sich jeder vorher klarmachen.
• Was bin ich bereit, zu erzählen? Was möchte ich erzählen?
• Was ist für mich tabu? Welche Themen, welche Aufnahmen?
• Warum möchte ich in die Medien?
• Wovor fürchte ich mich?
• Kann ich gut für mich sorgen?
(Quelle: Fee Rojas und Katrin Hartig, unveröffentlichtes Manuskript, 2014)