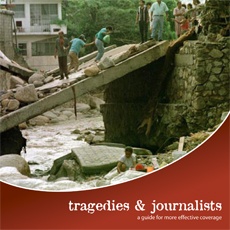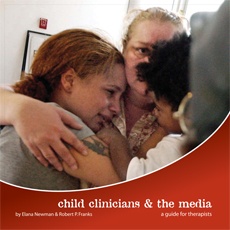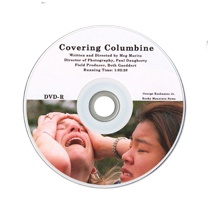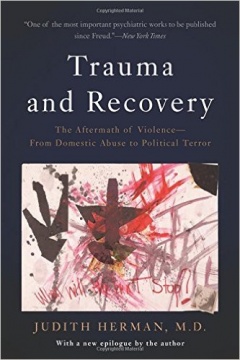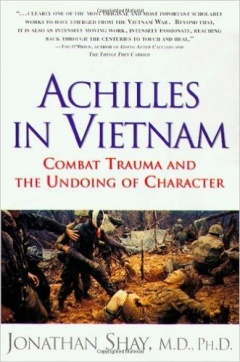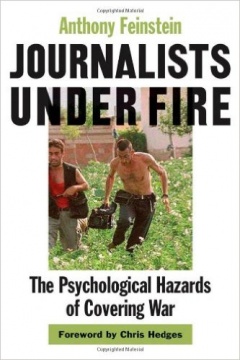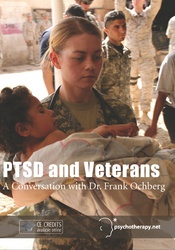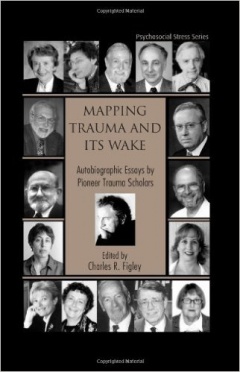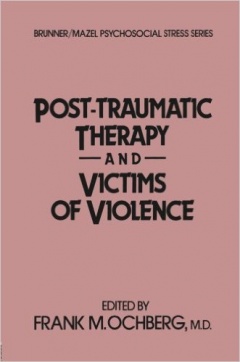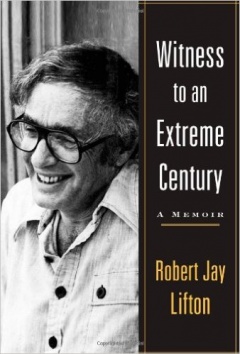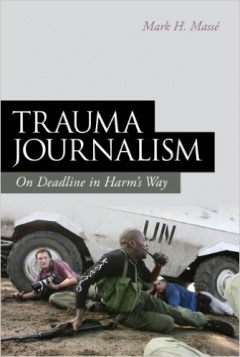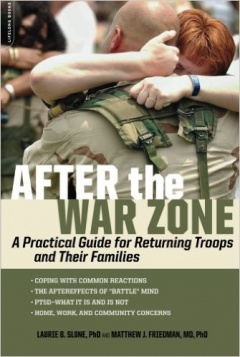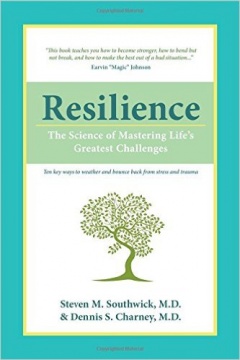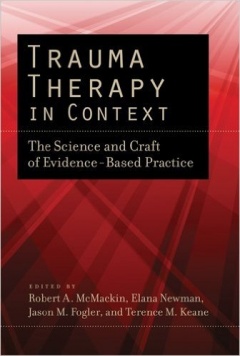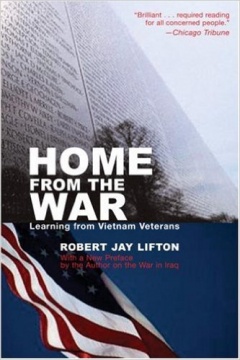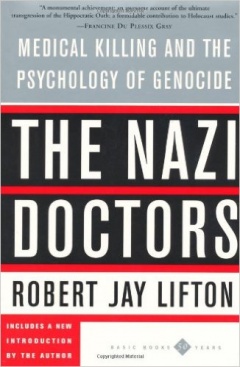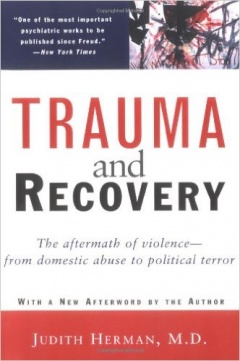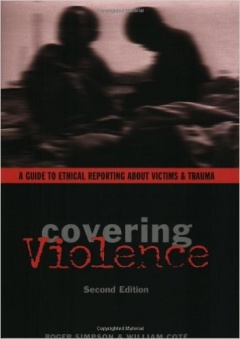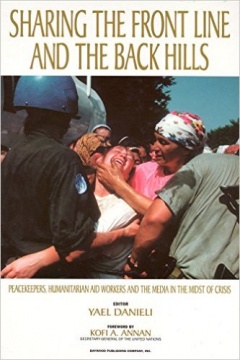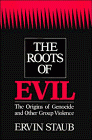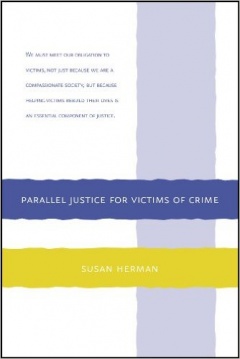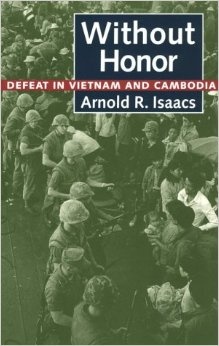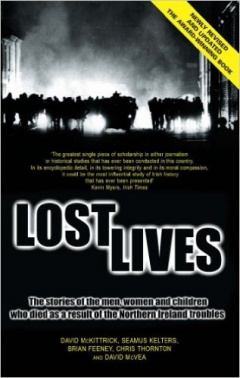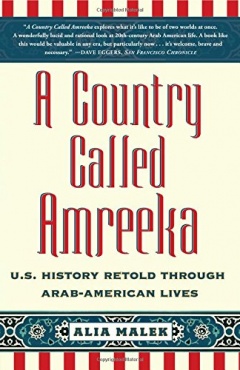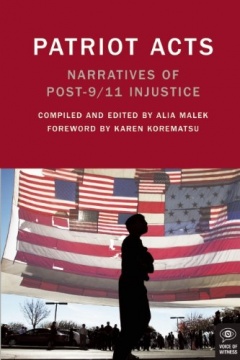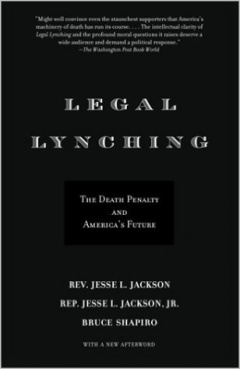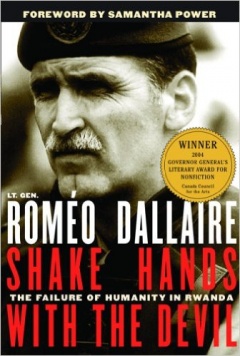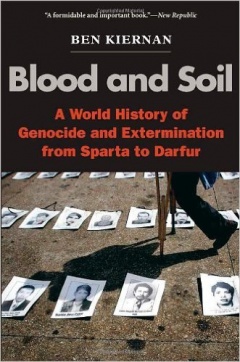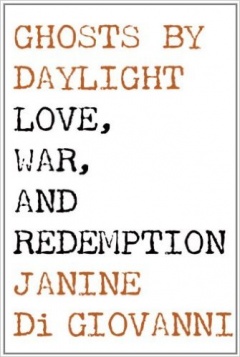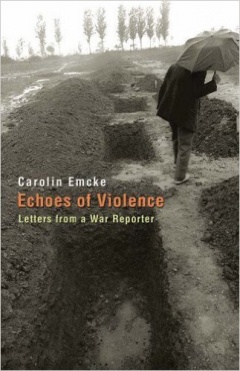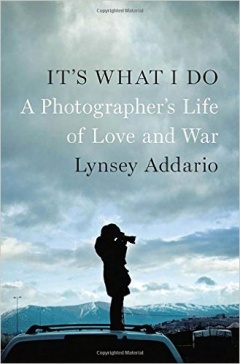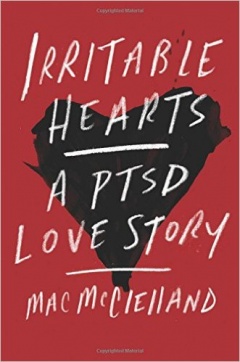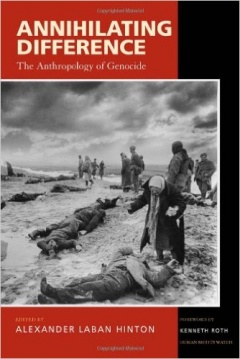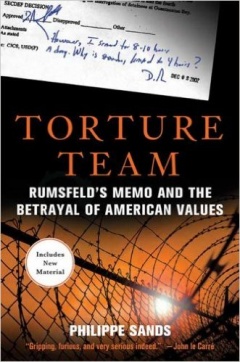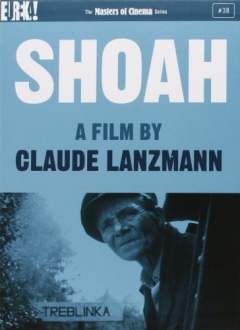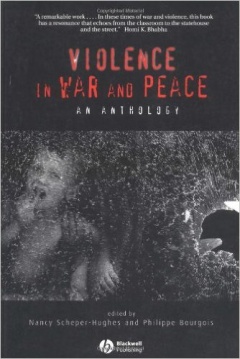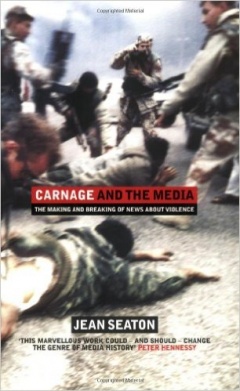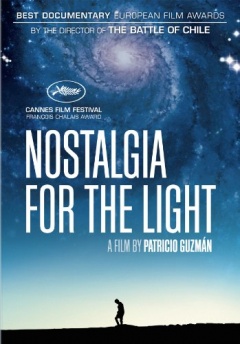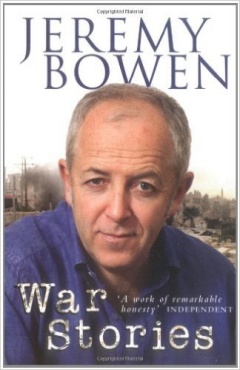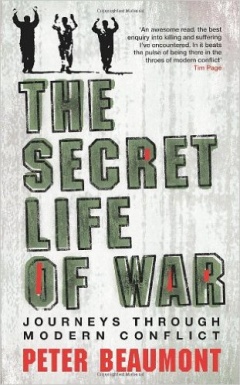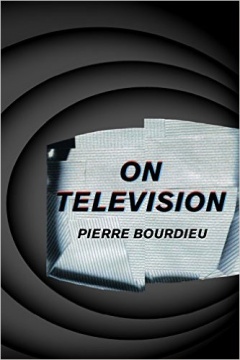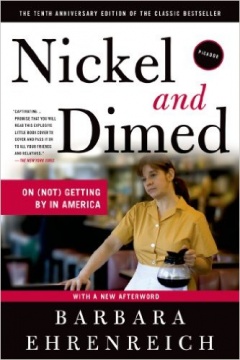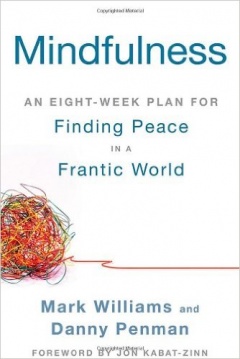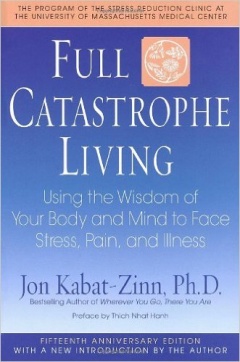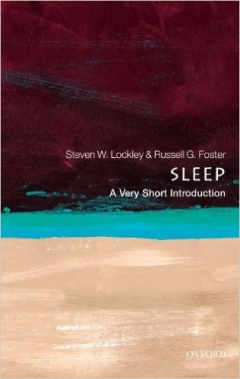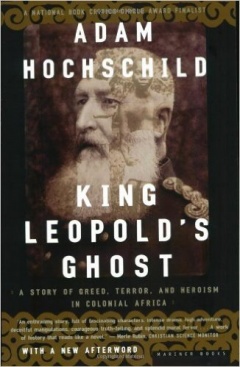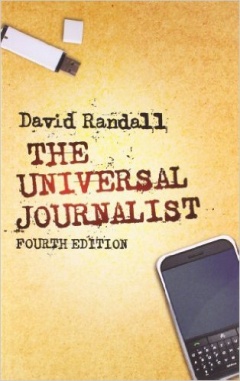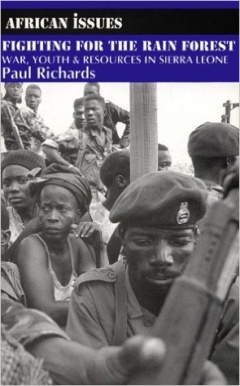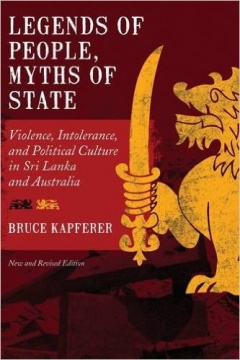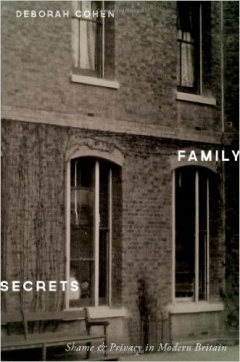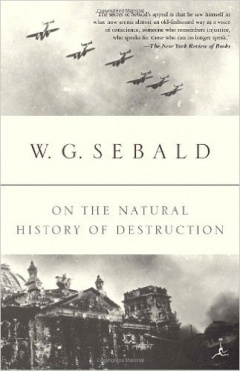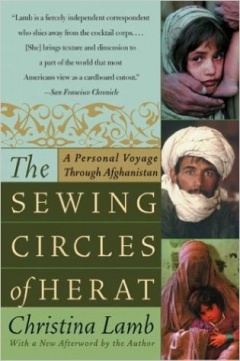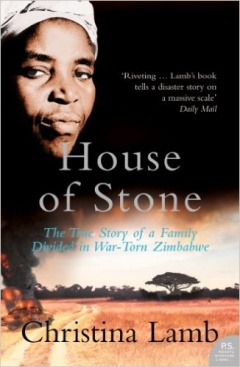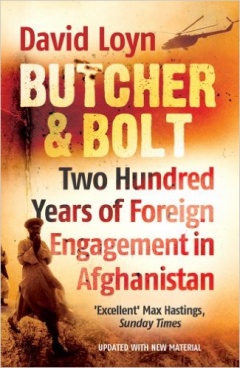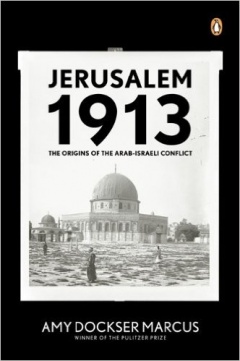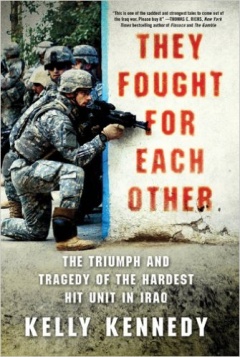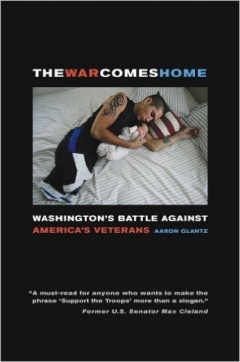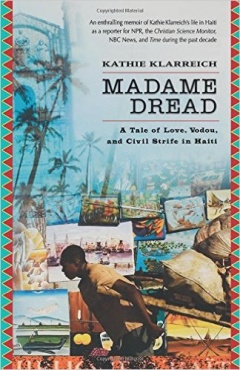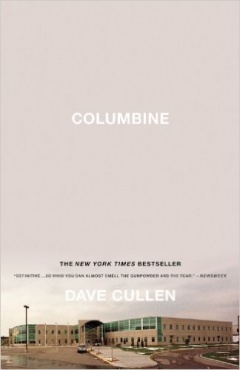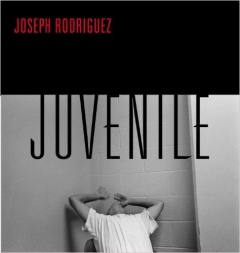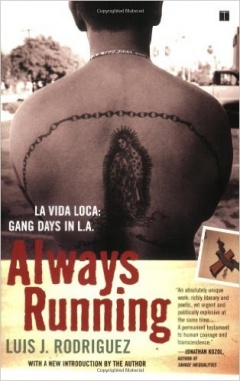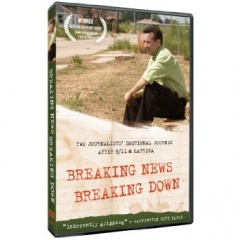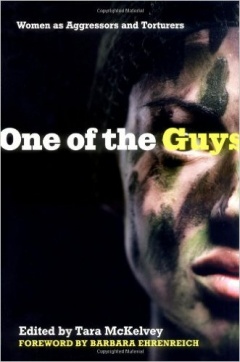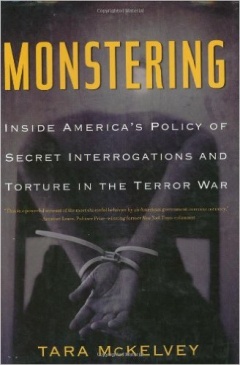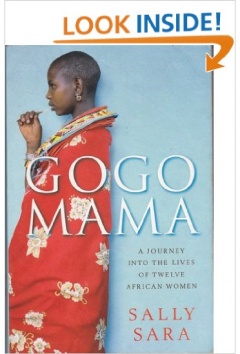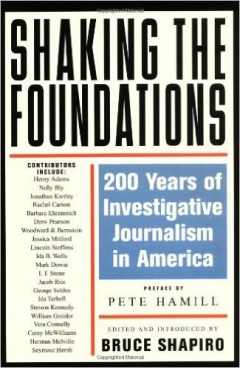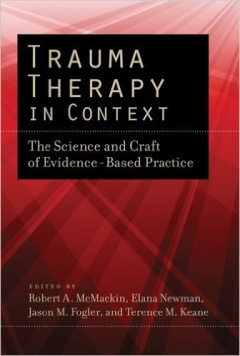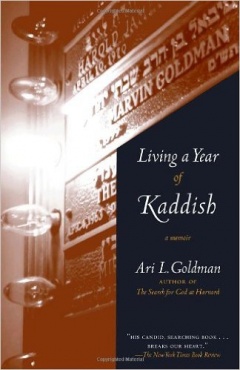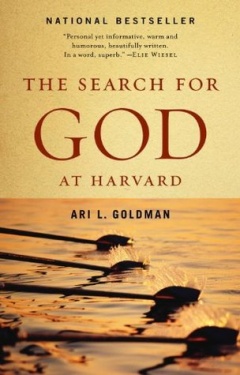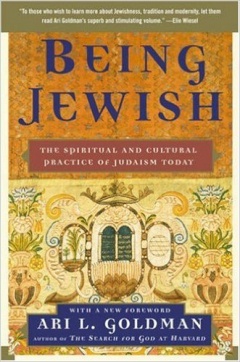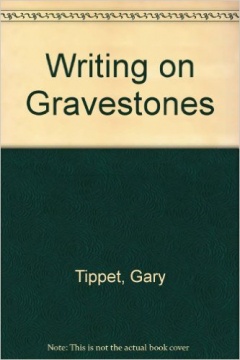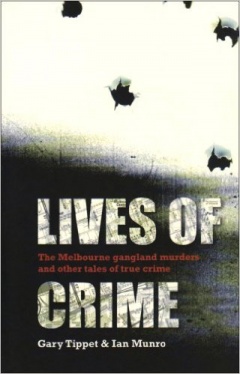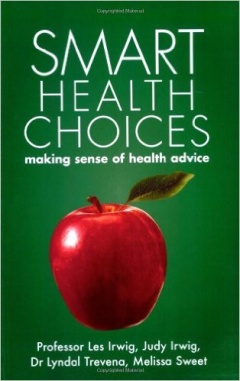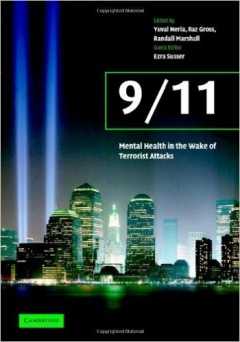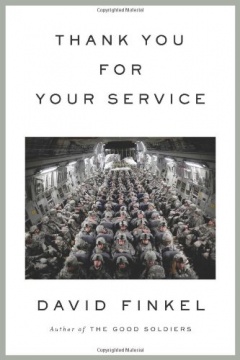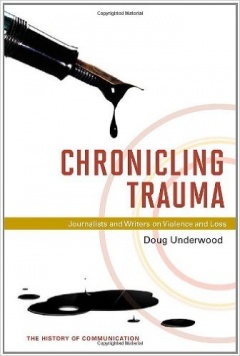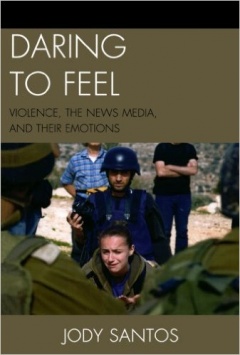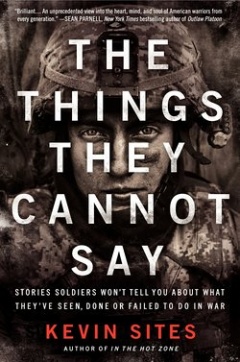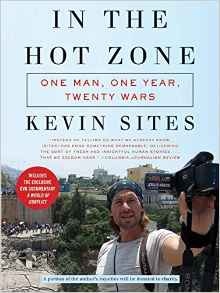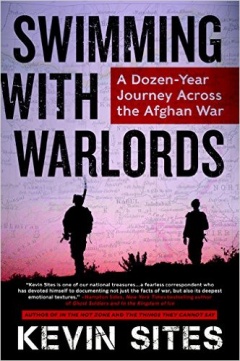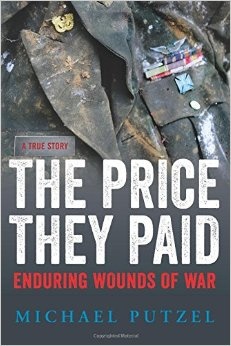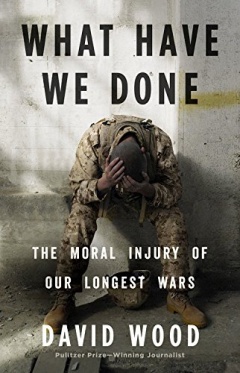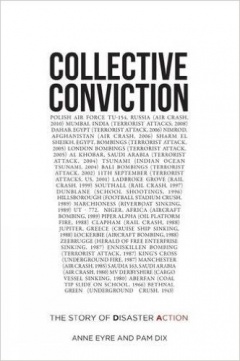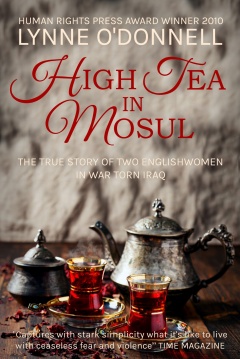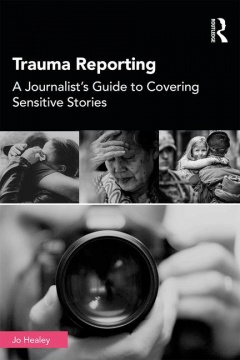Wie den Opfern eine Stimme geben?
Claudia Fischer reflektiert anlässlich der Ausstellungseröffnung "Der richtige Standpunkt. Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" in Hannover, über Opferberichterstattung. Wo ist die Grenze, welche Erwartungen haben Betroffene, Publikum und Journalisten, wann sind Berichte hilfreich und wie?
Claudia Fischer arbeitet seit vielen Jahren als freie Radio- und Fernsehreporterin für den WDR, dabei zeitweise aus Schottland. Seit Jahren befasst sie sich mit multiplen Persönlichkeiten und Gewalt gegen Frauen.
Seit ich das Buch von Natascha Kampusch („3096 Tage“, Berlin 2010) lese, die acht Jahre lang in einem Keller gefangen gehalten wurde, höre ich immer wieder: „Ach die, muss die denn jetzt auch noch ein Buch schreiben? Kann die nicht einfach Ruhe geben?“. Ich finde: Nein, Frauen und Mädchen, die Gewalt erlebt haben, dürfen keine Ruhe geben. Es ist das Verdienst von mutigen Frauen und Mädchen, die sich getraut haben, zu sprechen, dass es gegen sexuelle, meist familiäre Gewalt inzwischen Gesetze gibt und dass die Betroffenen heute Hilfe finden. Das war vor 40 Jahren noch nicht möglich.
Und auch ohne Berichterstattung wäre das nicht möglich gewesen. Betroffene und Medien arbeiten dabei eng zusammen. Wenn ein Mensch erzählt, werden andere Menschen berührt. Sie fühlen mit und lernen daraus. Im Idealfall werden sie sogar gegen ein Unrecht aktiv. Märchen, Fabeln, nicht zuletzt die Bibel funktionieren so. Menschen, die Gewalt erlebt haben, haben sehr bewegende Geschichten zu erzählen. Schwierig ist dabei, dass wir Gefahr laufen, sie durch unsere Berichterstattung erneut zu verletzen, zu missbrauchen, zu enttäuschen oder zu entmündigen.
Wir erwarten von Gewaltopfern, dass sie uns an ihren Erinnerungen, an Scham, Grausamkeiten und Schmerzen teilhaben lassen. Das ist peinlich - auch für uns, und trotzdem (oder vielleicht gerade deswegen?) starren wir wie Kaninchen auf die Schlange immer wieder auf das Schreckliche, und fragen nach Taten und Details. Ist das immer Voyeurismus auf seiten der Fragesteller? Kann es nicht auch Hilflosigkeit und der intensive Wunsch sein, mitfühlen und dadurch lindern zu wollen? Es erfordert ein Umdenken, sich von diesem Sog zu lösen und journalistisch gegenzusteuern.
Wir Journalisten nehmen uns viel heraus dabei: Wenn wir unser Gegenüber immer wieder fragen „Wie war das denn damals?“, womöglich sogar „Wie haben Sie sich gefühlt dabei?“, zwingen wir es dazu, das Grauen erneut zu erleben. Vor Gericht gibt es inzwischen verschiedene Formen, Zeugenaussagen möglichst verträglich für die Betroffenen zu gestalten. In Interviews werden häufig viel intimere Fragen gestellt, als ein Richter es je täte. Für Fotografen und Fernsehjournalisten ist es naheliegend, jemanden zu bitten, sich an den Ort eines Verbrechens zu begeben. Therapeuten nennen das „Konfrontationstherapie“ und besuchen teure Fortbildungen dafür, Medienvertreter suchen bildfixiert nach einer passenden Kulisse, ohne an die Folgen für die Betroffenen zu denken.
Natascha Kampusch konnte in ihrem Fernsehinterview wenige Tage nach Ihrer Befreiung vieles mitbestimmen. Das ist sehr ungewöhnlich. In der Journalisten- Ausbildung lernen wir, wie man Interviews straff führt, wie man ausweichende Antworten pariert und die Zügel in der Hand behält. Wir lernen nicht, Rücksicht zu nehmen. Natascha Kampusch hat sich die Souveränität über ihre Geschichte zurück geholt und nicht erst wochenlange Spekulationen abgewartet. Sie präsentiert sich bis heute als selbstbewußte Frau, die nicht in unser Opfer-Schema passen will. Und das hat ihr auch viel Kritik eingebracht. Unter anderem den oben schon zitierten Vorwurf „Kann sie nicht endlich mal Ruhe geben?“
Trauma-Fachleute wissen längst, dass die öffentliche Anerkennung eines Verbrechens ein wichtiger Faktor zur Heilung ist. Manche Frauen und Mädchen erstatten nur deshalb Anzeige vor Gericht. Nicht wegen des Urteils, sondern damit der Staat öffentlich anerkennt, dass ihnen ein Unrecht widerfahren ist. Andere wollen in die Medien. „Ich wende mich an die Presse, damit alle mit Fingern auf den Täter zeigen, der mir das angetan hat.“ Journalisten sind dann versucht, zu sagen: „Prima, wenn die Betroffene selbst will, dann verletze ich ja gar keine Schamgrenze.“
Aber Vorsicht: Wir werden hier instrumentalisiert. Was unterscheidet eine kämpferische Frau im Feldzug gegen ihre Peiniger von einer Pressestelle? Vielleicht die Tatsache, dass die Frau das gleiche will wie ich, nämlich Gewalt ächten oder verhindern. Was aber auf der Strecke bleibt, sind die Grundregeln unseres Berufs: Journalistische Distanz, der Check der Gegenseite, das Streben nach Objektivität, Fairness, um nur einige zu nennen.
Wie aber wahrt man Distanz bei einem Thema, das einen im Innersten berührt? Kann man über Gewalt berichten, ohne selbst berührt zu sein? Ist Distanz hier überhaupt angebracht? Soll man Frauen, die Gewalt erleben mussten, anerkennen, ihnen glauben und sie bestätigen, wenn das doch so ein wichtiger Aspekt von Heilung ist? Andererseits: Nicht Heilung, sondern Skepsis ist unser Beruf. Dieses Dilemma ist nur im Einzelfall zu lösen.
Fakt ist, die von Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen geben ihre Geschichte aus der Hand, wenn sie mit mir sprechen. Und auch ich habe keine volle Kontrolle über die Publikation. Ob frivole Dessous-Werbung neben meinem Bericht über das Frauenhaus erscheint, oder ob ein Moderator meinen Beitrag unsensibel anmoderiert, darauf habe ich häufig keinen Einfluss mehr. Nicht zuletzt können wir die Wirkung unserer Berichte nicht absehen.
Natascha Kampusch schreibt, dass sie sich schon im Alter von zehn Jahren für Berichte über verschwundene, missbrauchte und getötete Kinder interessiert hat. Und als sie in das Auto ihres Entführers gezerrt wird, wehrt sie sich nicht. Ihren Überlebenswillen findet sie erst Tage später wieder. Sie hat sich mit Opfern, getöteten Opfern, identifiziert. Häufig zeichnen wir ein Bild von Opfern, die keine Chance hatten. Vielleicht wollen wir damit aufrütteln, bewegen, motivieren, etwas gegen diese Verbrechen zu tun. Und gleichzeitig konstruieren wir eine Welt, in der am Ende steht: „Es gibt kein Entrinnen.“ Aus Kampuschs Buch habe ich gelernt: Das lähmt, das macht mutlos, das entmündigt. Das will ich nicht! Aber was ist die Alternative?
Wenn ich Geschichten erzählen will, die Mut machen gegen Gewalt, dann muss ich Stärken betonen. „Was hat Ihnen geholfen, die Situation zu überstehen?“ Ich muss mein Gegenüber respektvoll behandeln, mich sorgfältig vorbereiten, die Möglichkeit, Stoppsignale einzuräumen und die Möglichkeit zu geben, die Kontrolle zu behalten. Ich muss Zeit mitbringen und einen guten Zeitpunkt wählen – gut für mein Gegenüber, nicht für meinen Sendetermin. Nur dann bekomme ich auch ein gutes Interview.
Und nach diesem Interview geht es für Betroffene oft erst richtig los: Reue, Zweifel, Angst, weil sie „das Geheimnis“ verraten haben. Die journalistische Art der „Nachsorge“ ist, den Sendetermin mitzuteilen, mögliche Wiederholungen, Reaktionen auf das Gedruckte weiter zu geben. Das sind für Betroffene sehr wichtige Informationen für ihr Weiter-Leben mit der Öffentlichkeit. Für mich als Journalistin heißt das: So ein Thema kann ich nicht nach Abdruck zu den Akten legen. Es kostet Zeit, Energie, meist private Zeit, den Kontakt zu halten.
Es ist eine Gratwanderung zwischen Professionalität und Privatem, ein ständiges Ausloten von Nähe und Distanz und erarbeitet werden muss. Und nicht zuletzt muss ich aufpassen, nicht selbst psychisch verletzt und traumatisiert zu werden. Aber bei aller gebotenen Vorsicht und Verantwortung für uns, unsere Interviewpartner, unsere Teams und unser Publikum - Wir Journalisten haben eine große gesellschaftliche Aufgabe: Dass nicht geschwiegen wird bei Unrecht und Gewalt.
Dieser Vortrag von Claudia Fischer (gekürzte Fassung) wurde am 4. Oktober 2010 im Niedersächsischen Landtag zur Ausstellungseröffnung „Der richtige Standpunkt: Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ gehalten. Die Ausstellung wurde konzipiert vom Verbund der niedersächsischen Frauen- und Mädchenberatungsstellen gegen Gewalt. Lesen Sie die komplette Version hier.