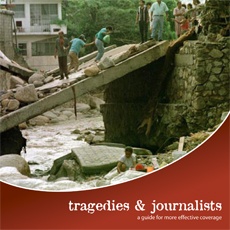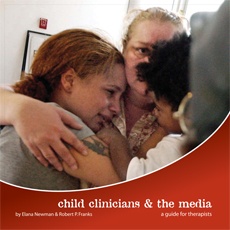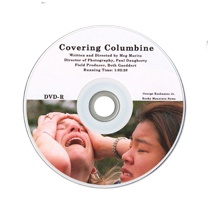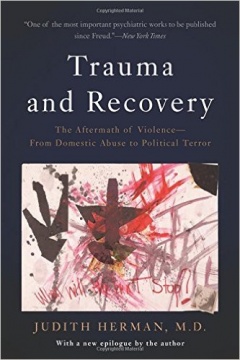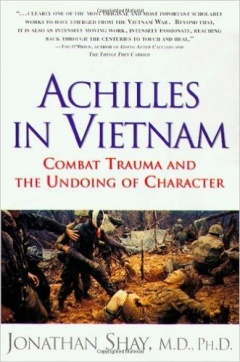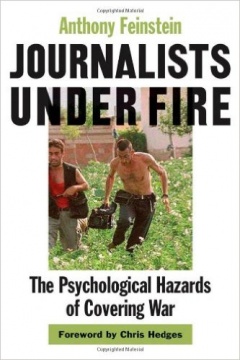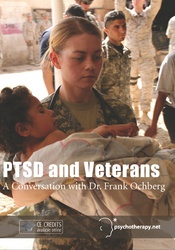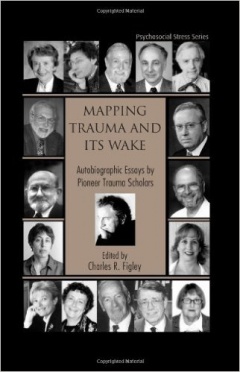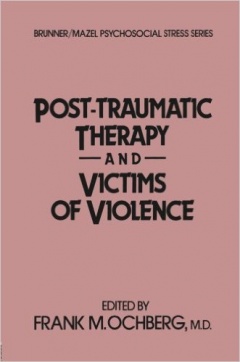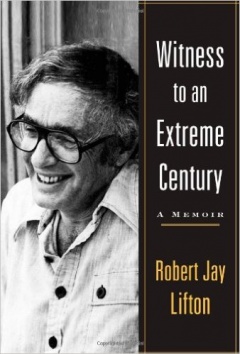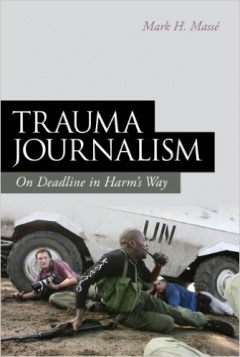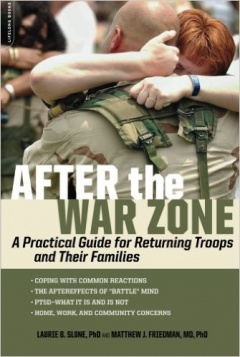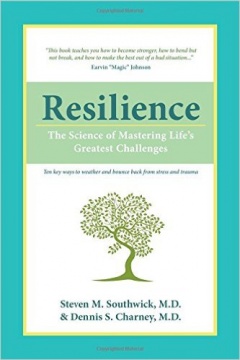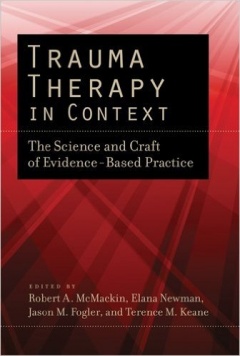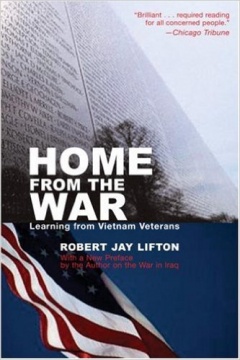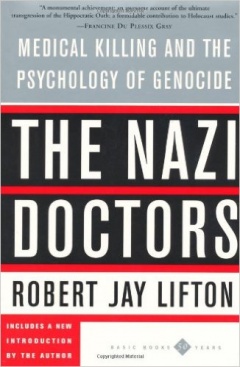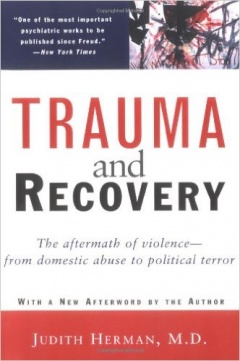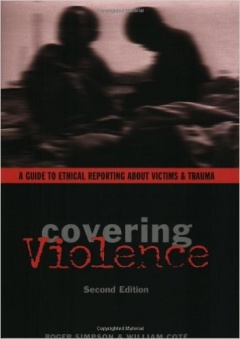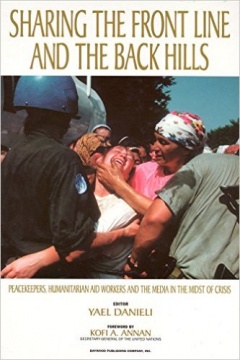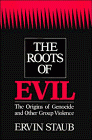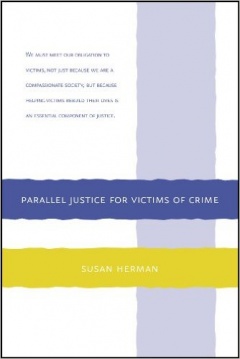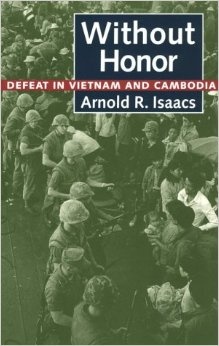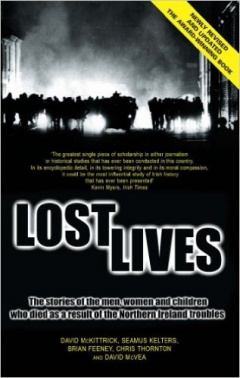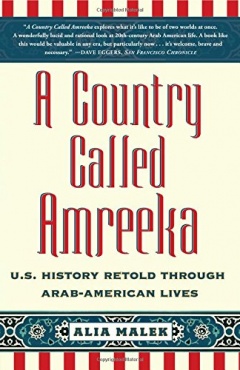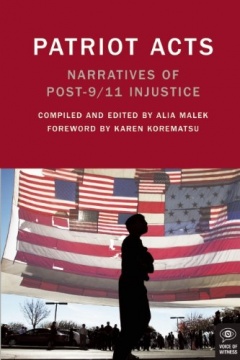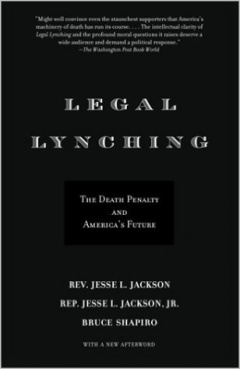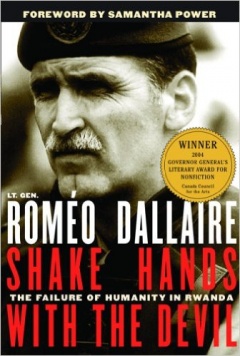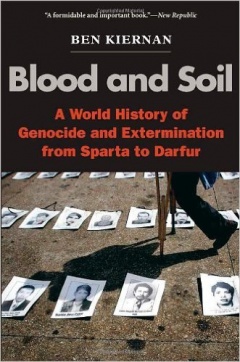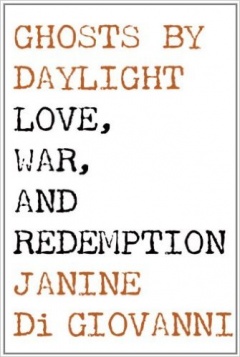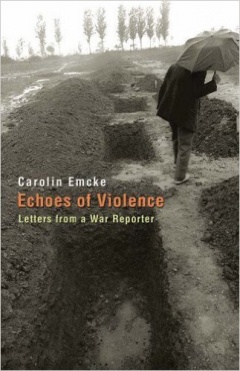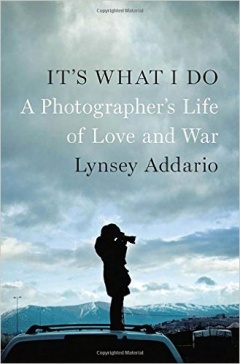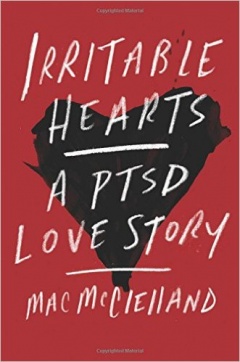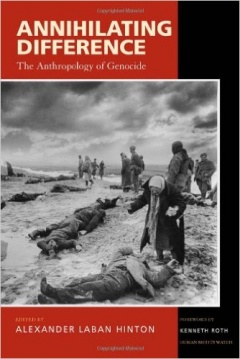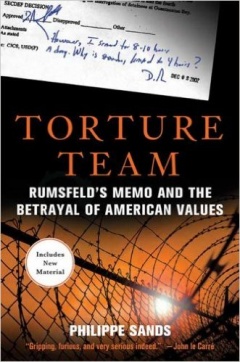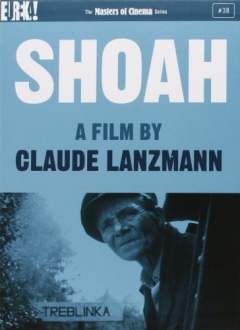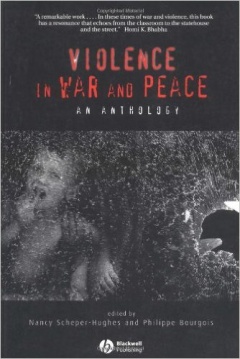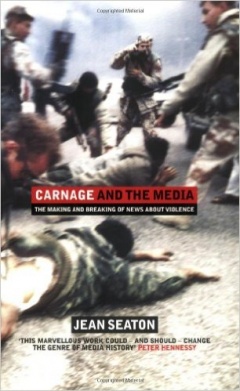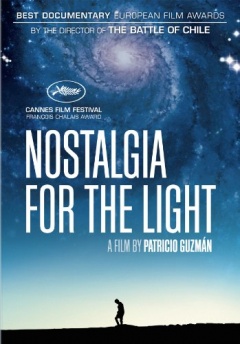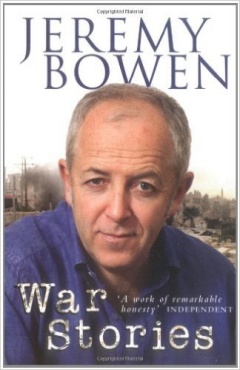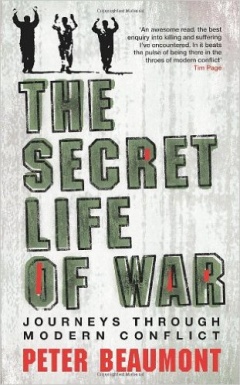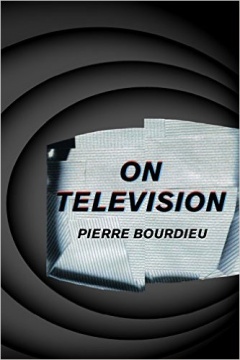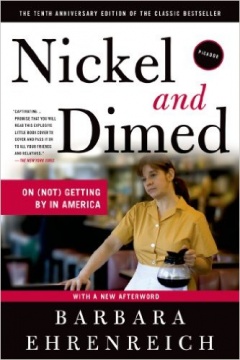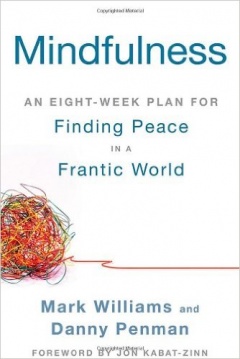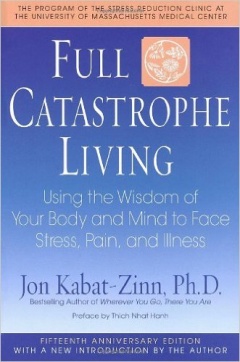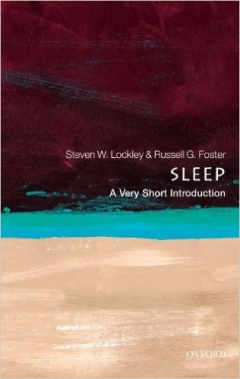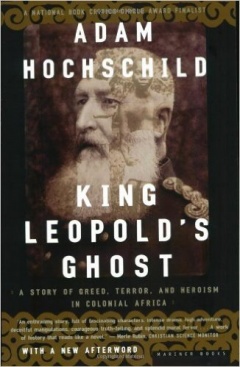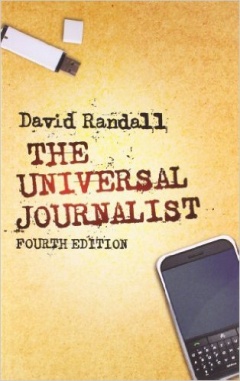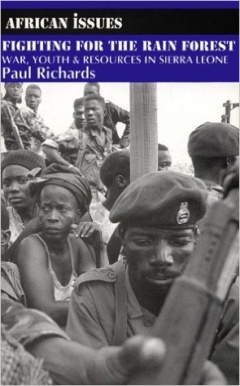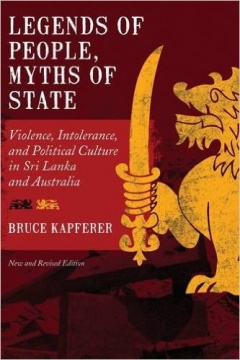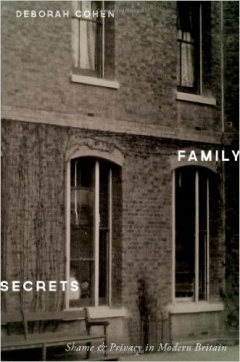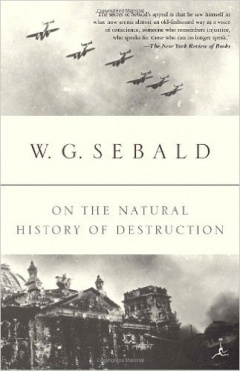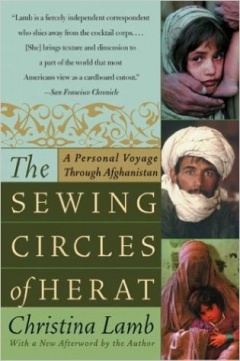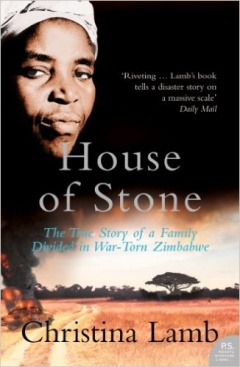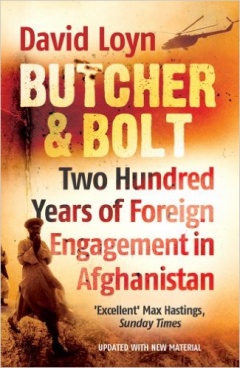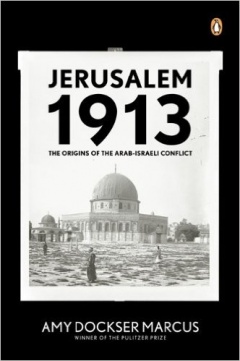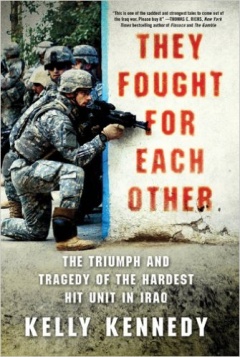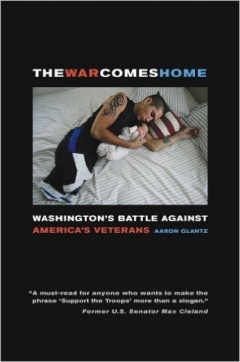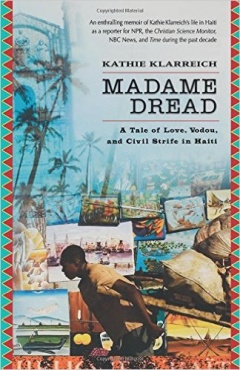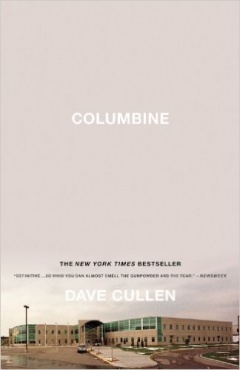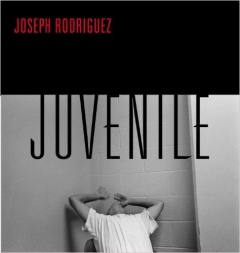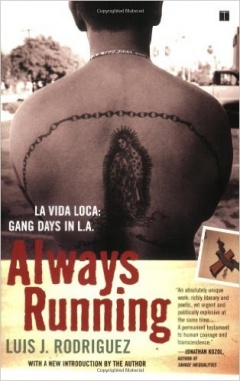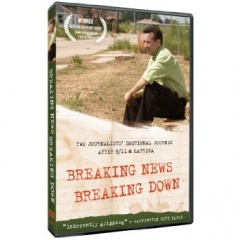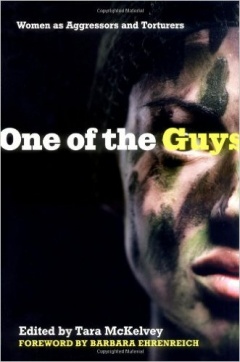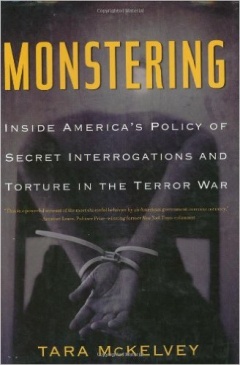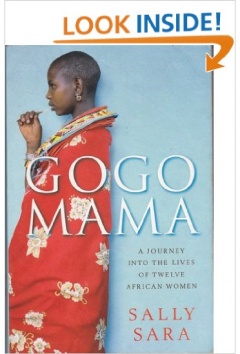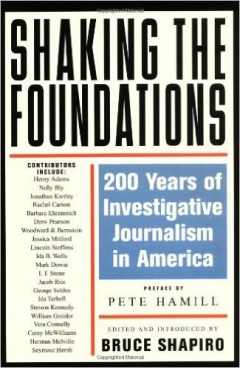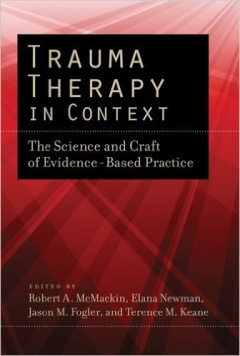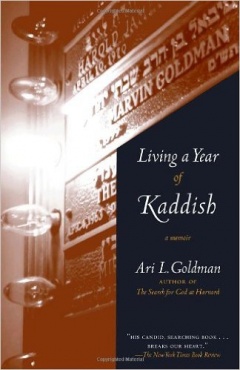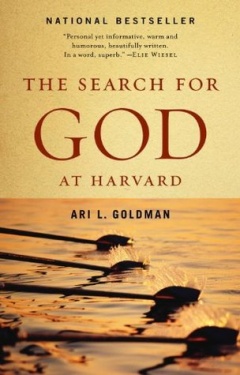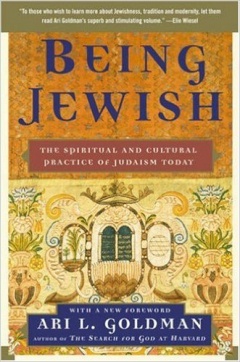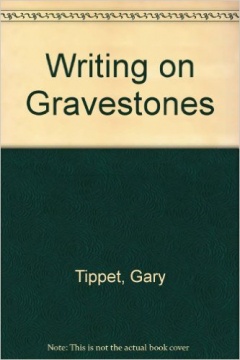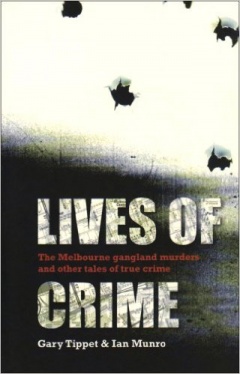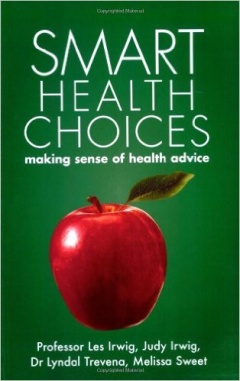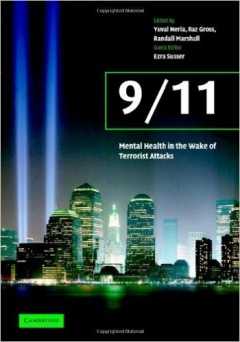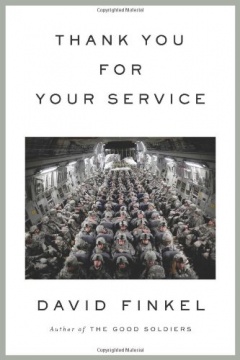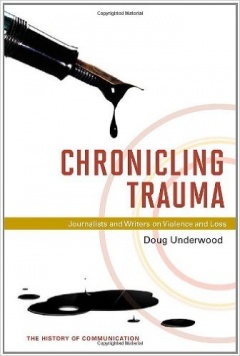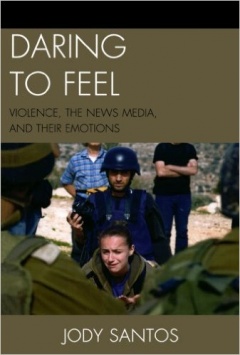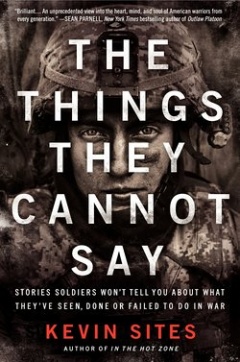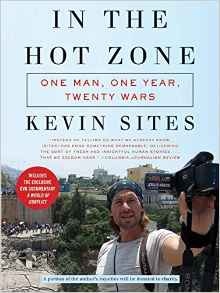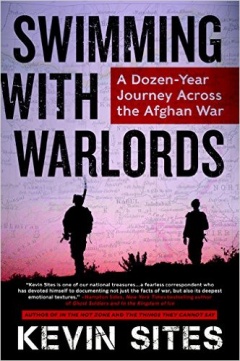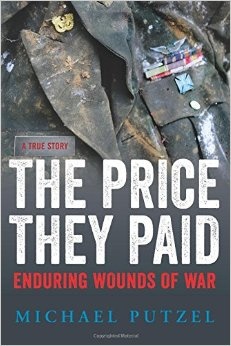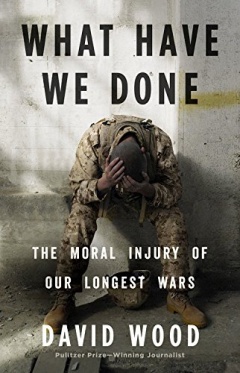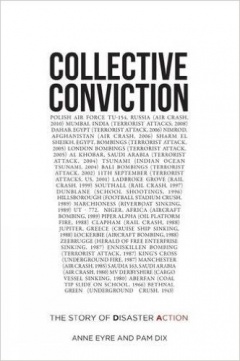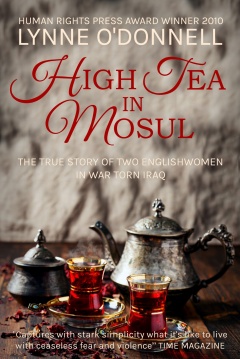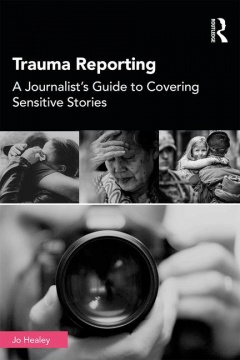Tipps für Interviews mit traumatisierten Menschen
Von Christiane Habenicht, Fernsehredakteurin
Als Reporter begegnet man verschiedenen Arten von Traumatisierung. Es gibt aktuelle Ereignisse, wie die Toten bei der Love-Parade oder die Amokläufe von Erfurt und Winnenden. Es gibt aber auch Berichterstattungen zu zurückliegenden traumatischen Ereignissen, wie die Bilanz des Weißen Rings zeigt. Dort geht es um Menschen, die Opfer eines Verbrechens geworden sind, oder die Missbrauchsskandale der Kirchen.
Als Journalist vor Ort muss ich mir vorab überlegen: Welche Geschichte will ich erzählen und wen konfrontiere ich mit meinem Mikrofon oder sogar mit der Kamera? Reicht es vielleicht auch aus, wenn ich bei aktuellen Ereignissen nicht die Opfer direkt anspreche, sondern Personen aus der „zweiten Reihe“ der Betroffenen? Zum Beispiel Menschen, die Opfer/Betroffene aus dem Sportverein kennen, den Bürgermeister, der sich vor der Kamera äußert, Notfallseelsorger, die beschreiben, wie es den Menschen nach dem Ereignis geht.
Bei zurückliegenden Ereignissen muss ich mir überlegen, wie ich mit den Opfern umgehe. Als Journalist muss ich immer im Blick haben, was ich mit meinen Fragen und der Berichterstattung auslöse. Im besten Fall kann ich helfen, das Erlebte zu verarbeiten und damit den Personen einen Weg aus der Opferrolle heraus ebnen, hin zu Menschen, die es schaffen, gestärkt in ein neues Leben zu gehen. Ich muss mir aber auch bewusst sein, dass ich im schlimmsten Falle eine Retraumatisierung auslöse und die Menschen zum zweiten Mal zum Opfer werden lasse.
Wie gehe ich auf die Betroffenen zu?
Wenn ich mir meiner Rolle bewusst bin und weiß, welche Geschichte ich mit welchen Personen erzählen will, dann erst gehe ich auf die Betroffenen zu. Wenn ich in aktuellen Situationen nicht persönlich auf die Opfer zugehen will, um sie zu schützen, kann ich den Kontakt auch über die Notfallseelsorger oder andere offiziell tätige Personen vor Ort suchen.
Zunächst einmal muss ich mich in meiner Rolle vorstellen und die Person muss dem Interview zustimmen. Wenn Sie eine Berichterstattung ablehnt, dann muss ich das akzeptieren und darf das Opfer nicht bedrängen. Reporter der elektronischen Medien sollten erklären, welche Technik auf die Betroffenen zukommt, dass eventuell noch ein Kamerateam dabei sein wird, und ebenfalls mitbekommt, was die Person erzählt. Ich sollte immer auch erklären, dass wir nicht live senden, sondern alles, was die betroffene Person erzählt, wiederholt werden kann und nur gesendet wird, wenn sie am Ende der Berichterstattung auch zustimmt.
Meiner Redaktion gegenüber sollte ich von Anfang an klar machen, dass es vorkommen kann, dass am Ende nichts gesendet oder geschrieben wird. Und dass das Material auch veröffentlicht wird, wenn sich die Person öffnet und zustimmt. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand von schrecklichen Erlebnissen erzählt, und die Redaktion am Ende es für „nicht wert genug“ befindet, es auch zu senden. Ich muss also vorher klare Grenzen abstecken. Und ich muss mich selbst schützen. Zum Beispiel muss ich versuchen, zu erkennen, wie belastbar ich selbst in einer Stresssituation bin. Im Notfall muss ich die Notbremse ziehen und mich ablösen lassen, außerdem sollte ich über alles sprechen – mit Freunden oder Kollegen. Wenn ich nach drei, vier Wochen immer noch nicht mit dem Erlebten fertig werde, dann sollte ich mir professionelle Hilfe suchen.
Auch sollte ich von Anfang an klar machen, wo der Bericht veröffentlicht wird, und ob eine zusätzliche Veröffentlichung online oder in sozialen Netzwerken für die betroffene Person in Ordnung wäre. Außerdem sollte ich deutlich machen, ob auch die andere Seite, sprich die „Täterseite“, zu Wort kommen soll.
Verfremdungen zum Schutz der Interviewpartner
Ich sollte von Anfang an klären, ob die Person erkannt werden möchte, oder ob sie anonym bleiben will. Dann kann ich noch vor dem Interview Möglichkeiten aufzeigen, wie das zu realisieren ist, beispielsweise durch einen anderen Namen, ein Pseudonym. Bei Fernsehinterviews kann ich Möglichkeiten der Verfremdung vorstellen, aber ich sollte die Person immer selber prüfen lassen, ob ihr das reicht. Außerdem muss ich mir selbst der Verantwortung bewusst sein und nicht wegen eines unzureichenden Effekts ein Erkennen riskieren. Im Notfall kann ich auch die Füße oder Hände einer anderen Person zeigen. Vor allem muss ich drauf achten, dass Besonderheiten, wie Narben oder ähnliches, nicht zu sehen sind. Außerdem muss ich bei elektronischen Medien immer darauf hinweisen, dass auch die Stimme wiedererkannt werden kann. Sollte das Opfer/der Betroffene wirklich nicht erkannt werden wollen, dann muss ich verfremden oder sogar nachsprechen lassen. Wichtig dafür: Auch Bekannte oder Verwandte können den Beitrag sehen, das Opfer erkennen. Insofern liegt es in unserer Verantwortung, so zu verfremden, dass selbst der Ehemann oder die Ehefrau die Person nicht erkennt.
Zeitdruck darf nicht dazu führen, dass ich meiner Verantwortung gegenüber der Person, mit der ich rede, nicht gerecht werde. Sollte ich wenig Zeit haben, darf ich das die Betroffene aber nicht spüren lassen. Ich kann beispielsweise Autofahrten zum Drehort dazu nutzen, mit ihr zu sprechen und abzuklären, was ihr wichtig ist. Ich kann sie auch den Drehort mit bestimmen lassen: wo fühlt sie sich wohl, wo habe ich Möglichkeiten, in Ruhe mit ihr zu sprechen, ohne dass sie jemandem begegnet, der sie kennt? Wo gibt es Möglichkeiten, zu verfremden und wie? Reden ist das Zauberwort – Angst nehmen und Vertrauen schaffen und dem Interviewpartner das Gefühl vermitteln, dass er entscheiden kann, wann er bereit ist und wie lange er bereit ist, mit mir zu reden und worüber (Nicht das Gefühl, fremdbestimmt zu sein – das entspricht der Opferrolle – sondern selbstbestimmt das Ruder in der Hand haben, um sich aus der Opferrolle zu befreien).
Liegt ein Ereignis erst gerade zurück, dann sollte ich darüber nachdenken, was für eine Rolle Betroffene haben. Beispiel Amoklauf Winnenden: dort haben Schüler, die dem Täter entkommen sind, beschrieben, dass er einen Kampfanzug getragen haben soll. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben hinterher, dass das nicht stimmt. Das heißt: Opfer sind keine verlässlichen Zeugen. Ich muss immer hinterfragen, ob das, was sie mir direkt nach der Tat erzählen, auch stimmt. Manchmal ist es deshalb besser, auf offizielle Personen zurückzugreifen, zum Beispiel Polizeisprecher.
Was ist Berichterstattung wert – wie weit darf ich gehen?
Zum Beispiel sollte ich nicht „auf die Jagd nach Opferfotos gehen“. Manchmal macht es viel betroffener, eine andere Bildsprache zu wählen – zum Beispiel hat die Tageszeitung in Winnenden nur die Frage „Warum?“ auf schwarzem Hintergrund gedruckt, trauernde Menschen nur von hinten und mit Abstand gezeigt – „Träne groß“ ist nicht nötig, um zu zeigen, dass Betroffene traurig sind, trauern und Abschied nehmen.
Familien sollten nicht bedrängt werden – die Mutter eines Opfers aus Winnenden sagte hinterher, sie habe bereits wenige Tage später gemerkt, dass das, was sie den Medien nach dem ersten Schock erzählt hat, wenite Tage später schon gar nicht stimmte. Dass sie vieles mit etwas Abstand ganz anders wahrnahm als Stunden nach der Tat. Vielleicht hilft es hier, erst einmal die „zweite Ebene“ Betroffener abzufragen – zum Beispiel im Sportverein des Dorfes oder ähnliches.
Auch bei der Berichterstattung über „Täter“ sollten wir uns genau fragen, was wir damit auslösen. Zum Beispiel für jugendliche mutmaßliche Straftäter, die selber Probleme haben und später die Chance auf Resozialisierung bekommen sollten. Und im Hinblick auf die Frage: „Was macht ein Bericht über Täter mit den Opfern?“
Die Rolle des Interviewers
Es ist nicht leicht, Interviews mit traumatisierten Personen zu führen.
Wichtig ist, so zu sprechen, dass mich mein Gegenüber versteht und selber in der Lage ist, Worte für das Erlebte zu finden – nicht von oben herab fragen, sondern umgangssprachlich eine Ebene für ein Gespräch auf Augenhöhe finden.
Viele Journalisten stellen sich die Frage: Inwiefern darf ich eigene Gefühle zulassen? Verbal darf ich äußern, was ich fühle – darf Mitgefühl zeigen. Nicht aber Angst oder Trauer. Meine Mimik und Gestik sollte ich im Griff haben. Sollte ich es im Live-Interview (ohne ein Opfer dabei vor die Kamera zu ziehen), z.B. bei der Berichterstattung über die „Loveparade“, nicht schaffen, dann muss ich mich als Journalist nicht schämen. Ich muss aber professionell schnellstmöglich zurückgeben und sagen, dass ich mich zu dieser Zeit nicht in der Lage sehe, weiter neutral über das Ereignis zu berichten. Vielleicht ist das auch der Zeitpunkt zu erkennen, dass ich selbst überfordert bin und mich – zumindest auf Zeit – ablösen lassen, um das Ganze auch für mich zu verarbeiten.
Unsere Aufgabe als Journalisten: wir müssen die Informationen vor Ort an Leser oder Zuschauer weitergeben, sie ihnen verständlich vermitteln. Und wir sollten wissen, wohin wir mit unserer Berichterstattung steuern (zielgerichtet).
Wir sind keine Therapeuten oder Helfer in der Situation, sondern müssen den nötigen Abstand wahren. Wir sind aber auch keine Automaten und damit nicht unfehlbar. Wir müssen unsere Schwäche nur rechtzeitig erkennen und einlenken – zur Not muss das die Redaktion machen, wenn der Journalist vor Ort dazu nicht mehr in der Lage ist.