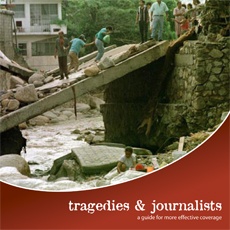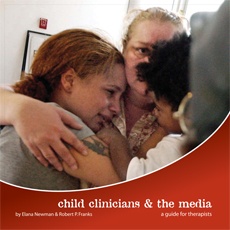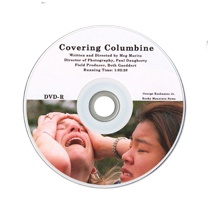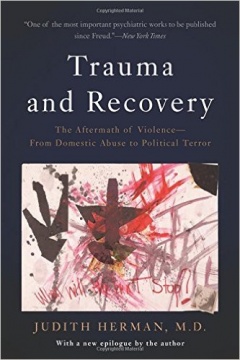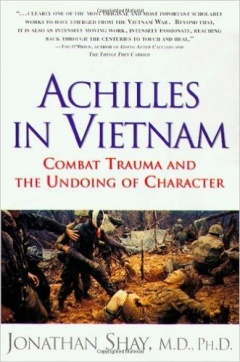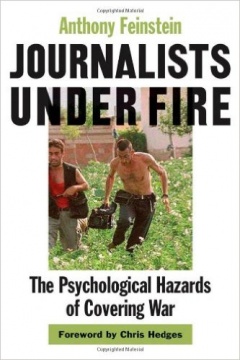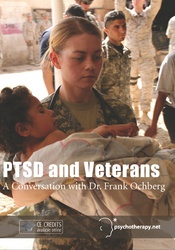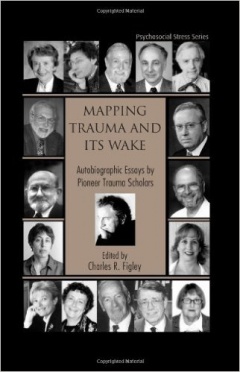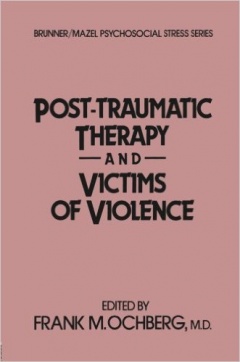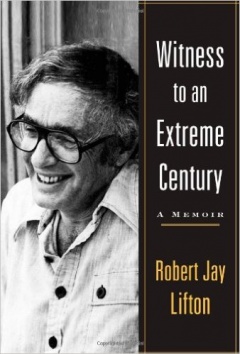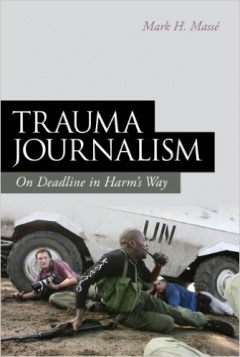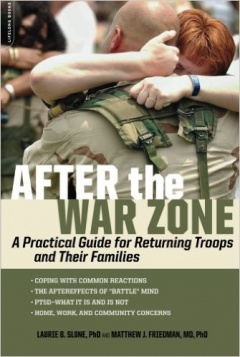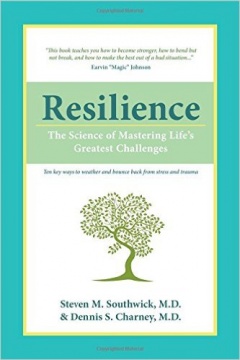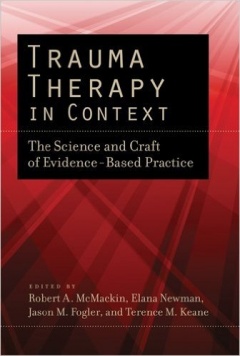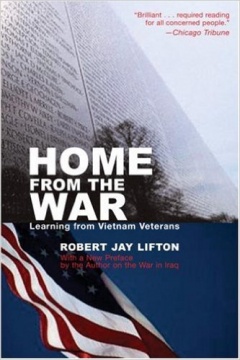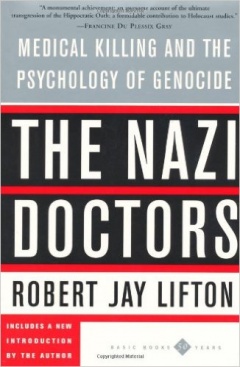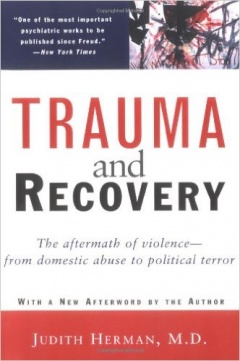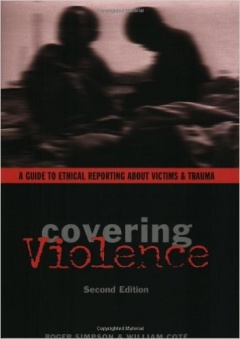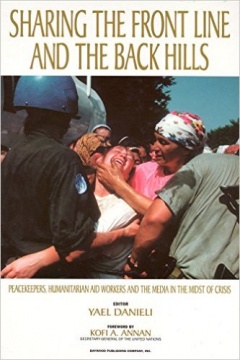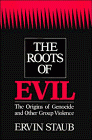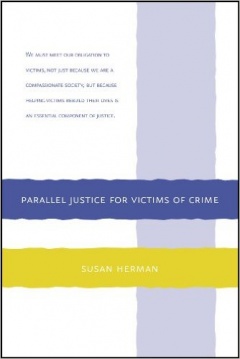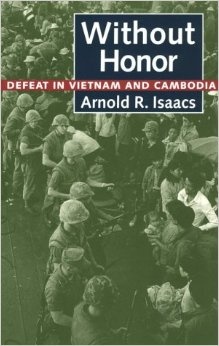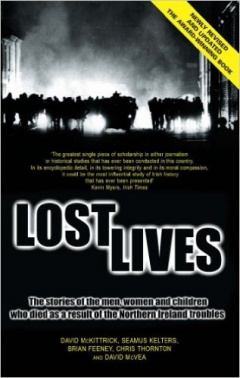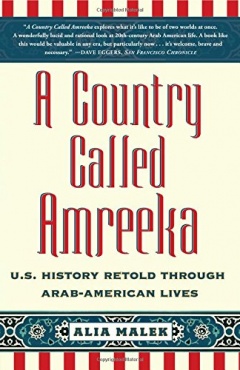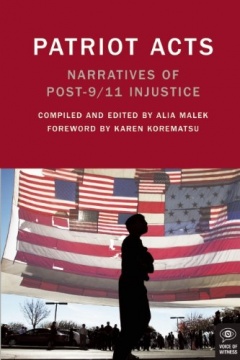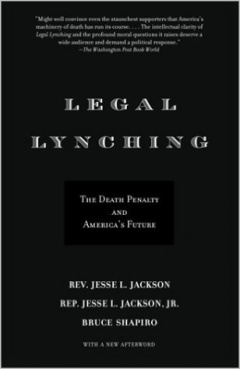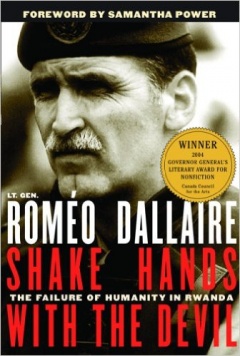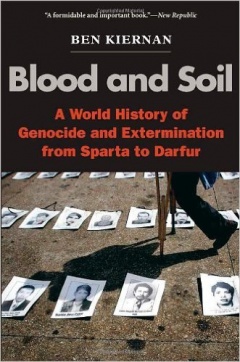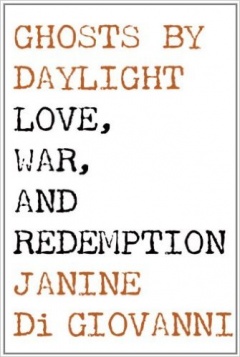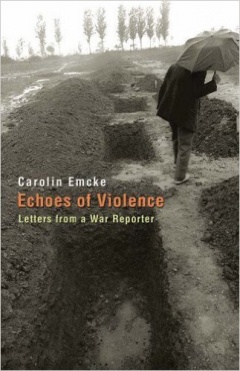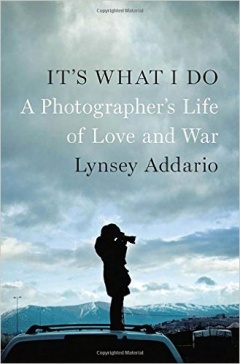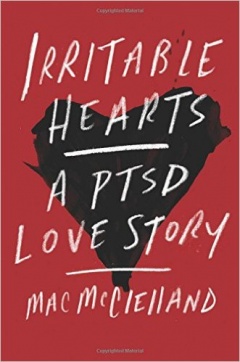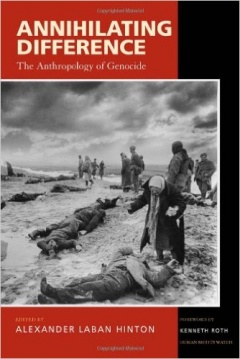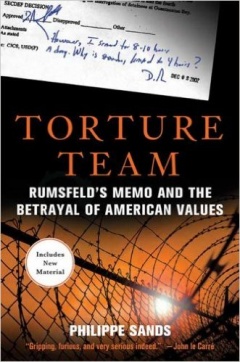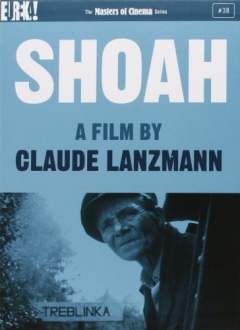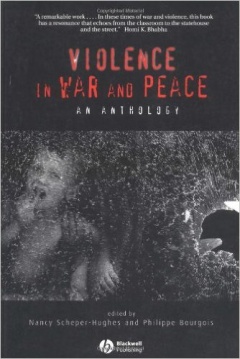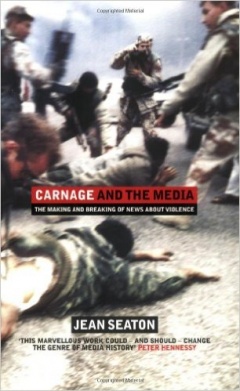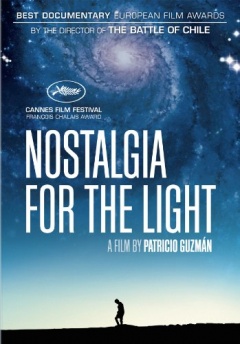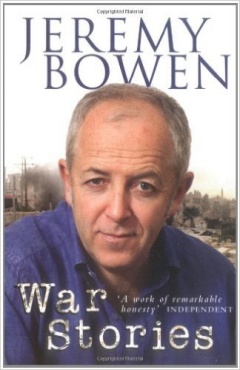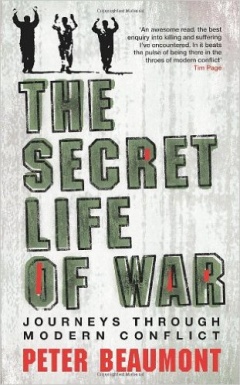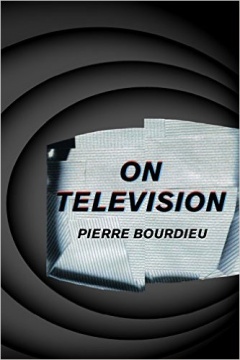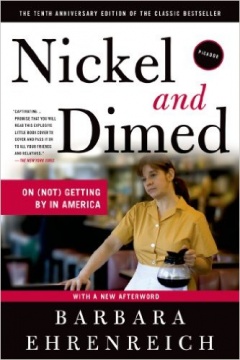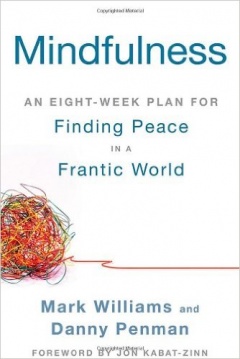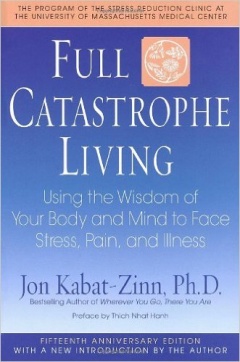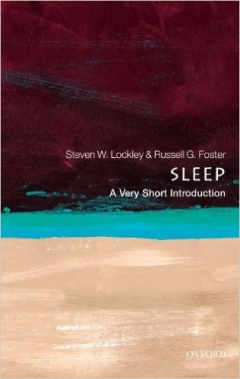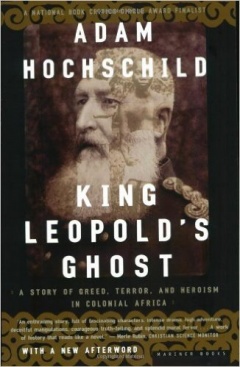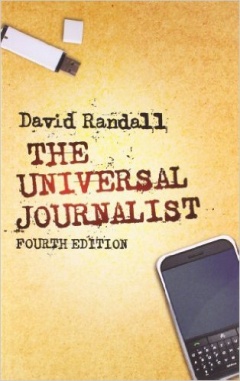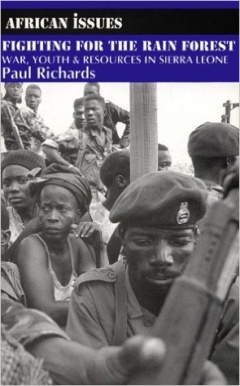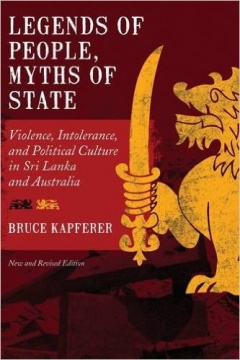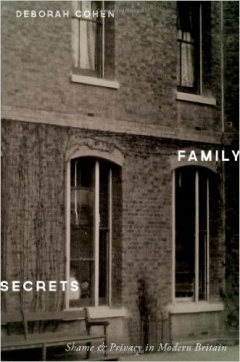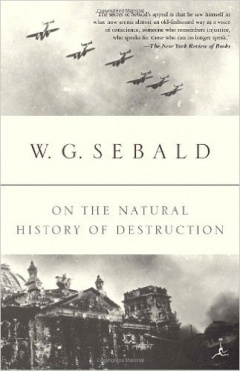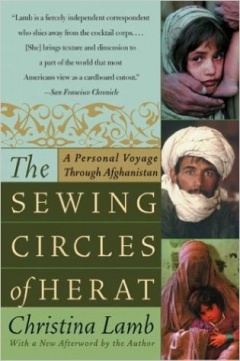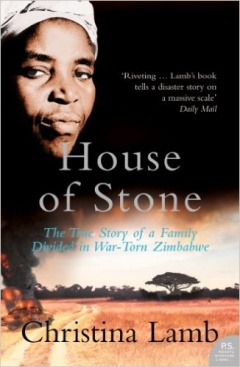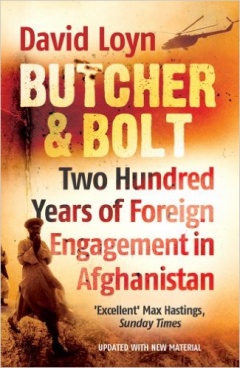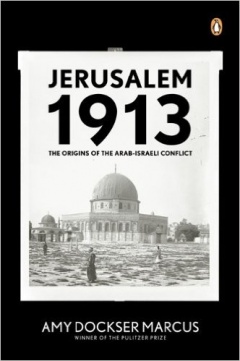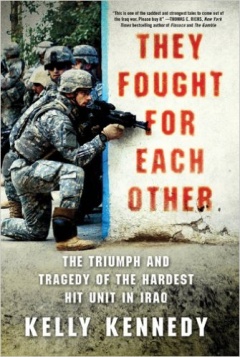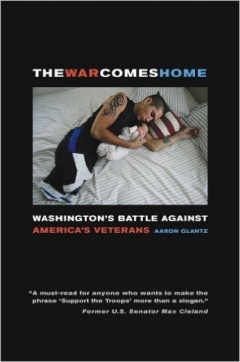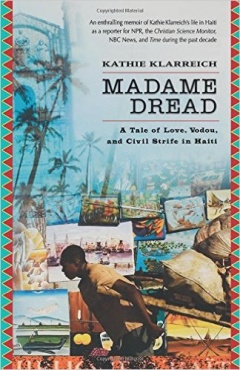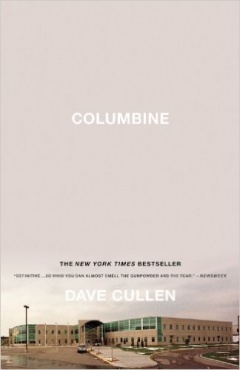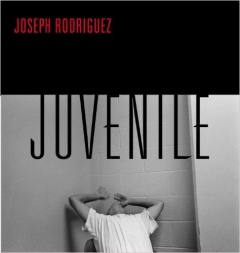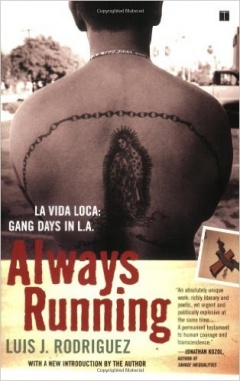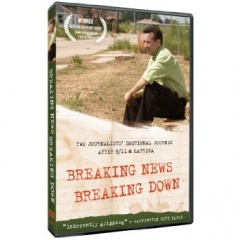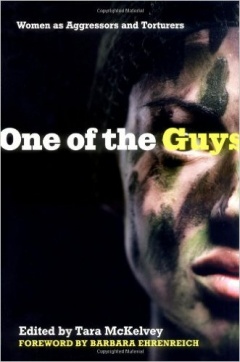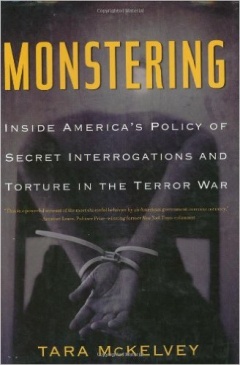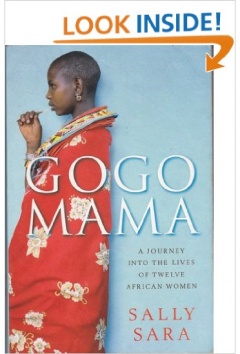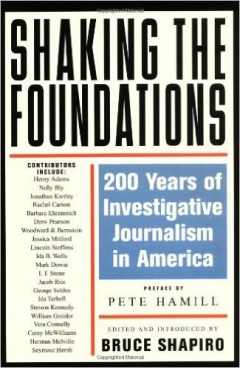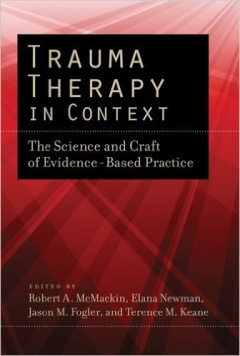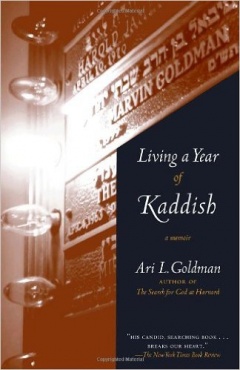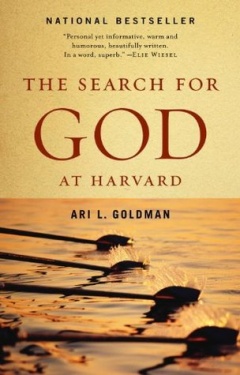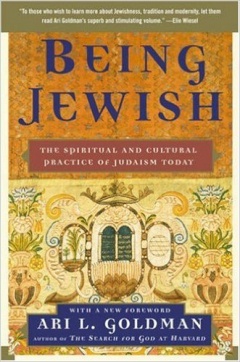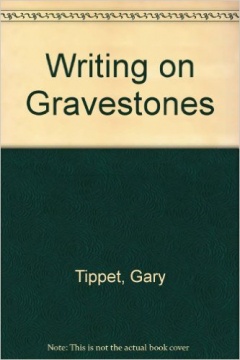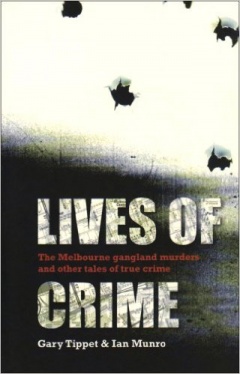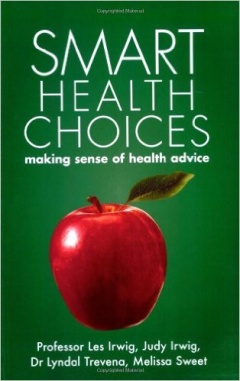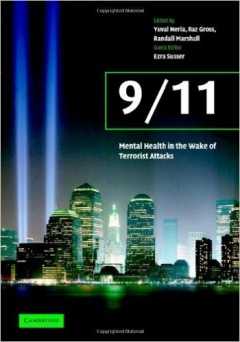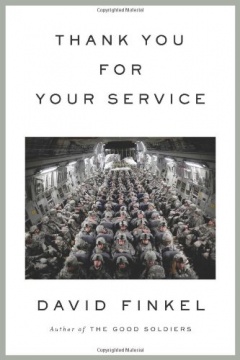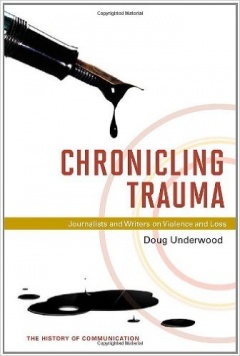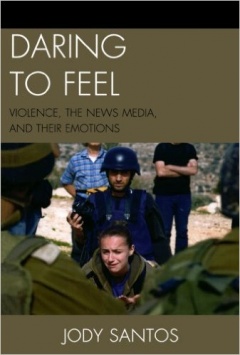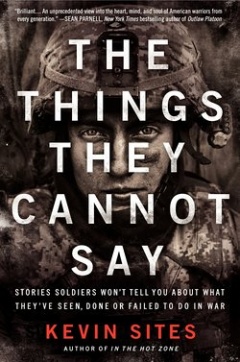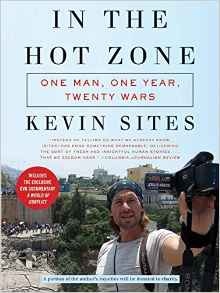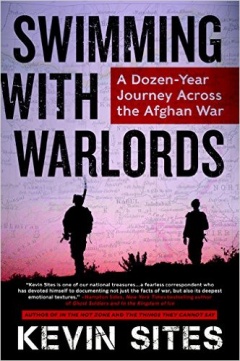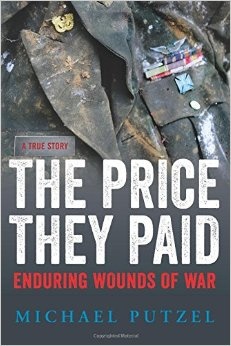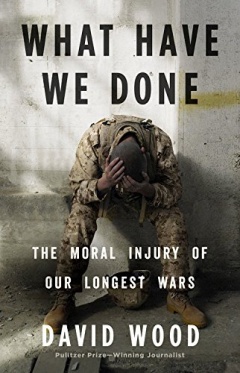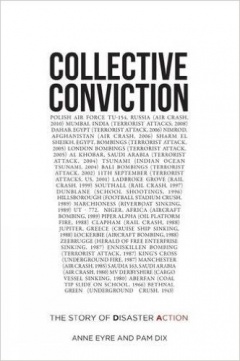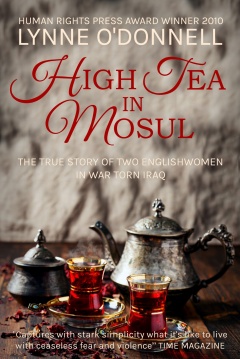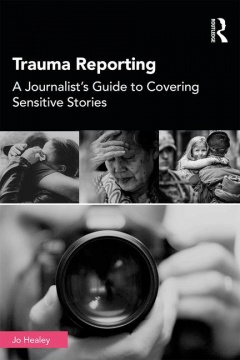2015: Physisch und psychisch gesund bleiben
Journalisten haben einen gefährlichen Beruf. Vor allem in Krisenländern kommen Jahr für Jahr viele Medienschaffende um – weil sie zufällig in bewaffnete Auseinandersetzungen geraten oder weil sie gezielt getötet werden. Hinzu kommen psychische Schäden, denn viele Erlebnisse können Traumata hervorrufen. Petra Tabeling in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift E+Z.

Im August des Jahres 2014 veröffentlichten IS-Terroristen grausame Videos, die die Hinrichtung der US-Journalisten Jim Foley und Steven Sotloff vor laufender Kamera zeigen. Diese Taten haben der westlichen Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass ausländische Korrespondenten in Krisengebieten zur Zielscheibe geworden sind. Heimische Journalisten, die in Konflikt- und Krisenregionen leben, sind dagegen ständig mit Gefahren für Leib und Seele konfrontiert.
Laut Zahlen der Menschenrechtsorganisation „Reporter ohne Grenzen" wurden 2013 über 71 Journalisten sowie 39 Blogger und Bürgerjournalisten getötet. 87 wurden entführt – das sind weltweit mehr als doppelt so viele wie 2012. Hunderte wurden inhaftiert und gefoltert. Syrien, Eritrea und Somalia sind die gefährlichsten Länder für Medienleute. Gefährlich ist es auch in Ländern wie Mexiko, wo der Kampf gegen die Drogenmafia täglich Opfer fordert.
Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in Mexiko in den vergangenen zwölf Jahren 80 Berichterstatter bei der Ausübung ihres Berufs getötet worden oder verschwunden. Die Organisation „Reporter ohne Grenzen" stellt Mexiko auf eine Stufe mit gefährlichen Ländern für Journalisten wie dem Irak und Pakistan und spricht von einer „Kultur der Gewalt gegen die Presse".
Seit 1992 wurden mehr als 1083 Journalisten und Medienarbeiter getötet. Laut dem unabhängigen, in New York ansässigen „Committee to Protect Journalists" waren die meisten nicht Kriegs- oder Krisenkorrespondenten, sondern lokale Pressevertreter. Sie werden häufig von Terroristen, von Sicherheitspersonal und manchmal sogar von der Polizei bedroht, entführt, verfolgt oder gefoltert. Gerade Lokaljournalisten sind extrem exponierte mögliche Opfer. Die meisten Übergriffe werden nicht juristisch verfolgt und bleiben straffrei. In Mexiko werden beispielsweise nur etwa zwei Prozent der Täter, die Journalisten angreifen, bestraft. Dieser Umstand führt zu Selbstzensur der Medien und permanenter Angst.
Im Artikel 19 der allgemeinen UN-Erklärung der Menschenrechte heißt es, dass jeder das Recht auf freie Meinung und Meinungsäußerung hat sowie das Recht auf Sicherheit. Diese Rechte umzusetzen, ist nicht immer einfach. Mittlerweile gibt es vereinzelt Trainings für Journalisten und Kameraleute, um sich für Kriseneinsätze zu wappnen. Allerdings gibt es bislang kaum Möglichkeiten, um sich auf die seelische Belastung durch die Arbeit in Konfliktgebieten vorzubereiten, wo Reporter Zeugen unvorstellbarer Gewalttaten werden können.
Belastende Erlebnisse
Viele unterschätzen auch die emotionalen Nachwirkungen ihrer Einsätze wie ungewollte Erinnerungen, Albträume oder Flashbacks. Die Journalisten müssen außerdem damit umgehen, dass sich diese seelischen Belastungen bei jedem Kriseneinsatz wiederholen, ob in Syrien, dem Irak oder Afghanistan. Der damalige Russland-Korrespondent des Schweizer Fernsehens, Gregor Sonderegger, berichtete 2004 live aus Beslan in Nordossetien-Alanien, wo Terroristen eine Schule besetzten und mehr als 1000 Geiseln nahmen. Bei dieser Tragödie im Nordkaukasus kamen mehr als 330 Menschen ums Leben, darunter viele Kinder. „Ich habe nie zuvor gesehen, wie Kinder sterben. Hätte ich damals Kinder gehabt, hätte ich nicht über Beslan berichten können", sagt der heutige Familienvater.
„Man kann nicht mit einer solchen Situation allein fertig werden", meint Roosevelt Jean Francois, Direktor der Journalistenorganisation CECOSIDA in Haiti über das verheerende Erdbeben im Jahr 2010 in seinem Land. „Zunächst funktioniert man wie auf Autopilot, man berichtet ununterbrochen, fokussiert sich darauf. Aber später kommt es zu dir zurück."
Seelische Langzeitschäden
Bruce Shapiro, der seinerzeit als investigativer Journalist in New York arbeitete, wurde 1994 in den USA Opfer eines Amokläufers. Er überlebte den Anschlag und musste selbst die Erfahrung machen, als Gewaltopfer von Kollegen für ein Interview bis ins Krankenhaus verfolgt zu werden. Das änderte seine Sicht auf den Journalismus. Gemeinsam mit dem Psychiater Frank Ochberg und mit finanzieller Unterstützung der amerikanischen Industriellenfamilie Dart gründete Shapiro 1999 das „Dart Center for Trauma and Journalism", das heute an der Columbia University in New York angesiedelt ist.
Dieses kleine Institut ist weltweit bislang die einzige Einrichtung, die Journalisten dafür aus- und weiterbildet, dass sie sensibel und sachkundig über Tragödien und Gewalt Berricht erstatten. Das Dart Center stemmt sich gegen den Macho-Mythos, ein Journalist sei stets der hartgesottene Reporter, der mit den Kriegen und Krisen dieser Welt alleine und aus reiner Intuition umgehen kann. Eine Studie des kanadischen Psychiaters Anthony Feinstein aus dem Jahr 2004 zeigte auf, dass die Gefahr für psychische Folgeschäden besonders bei Krisen- und Kriegsjournalisten sehr hoch ist. Seine Umfrage unter 140 internationalen Journalisten ergab, dass 28 Prozent im Laufe ihrer Karriere an einer Posttraumatischen Belastungsstörung – kurz PTBS – leiden. In einer neueren Studie untersuchte Feinstein 2012 exemplarisch die Lage von Journalisten, die im eigenen Land unter permanenter Bedrohung und Gewalt arbeiten. Beispiel Mexiko: Von 104 befragten Journalisten, die über Drogen- und Bandenkriege berichteten, entwickelten 25 Prozent PTBS-Symptome von PTBS, darunter Depressionen. Aufgrund der täglichen Bedrohung mussten sie ihre Arbeit einstellen.
Nicht jeder Journalist, der über Kriege und Krisen berichtet, wird traumatisiert. Aber es kann zu unerwünschten Angststörungen kommen. Erlebte Geräusche, Bilder, Töne, Gerüche können sich so in die Erinnerung eingebrannt haben, dass sie sich verselbständigen.
Das kann dazu führen, dass Journalisten Angst vor Silvesterraketen im sicheren Zuhause entwickeln, nachdem sie längst von einem Einsatz aus einem Kampfgebiet zurück sind. Es kann zu Angst vor Menschenmassen oder sexuellen Übergriffen führen – wie etwa auf dem Tahrir-Platz in Kairo erlebt –, oder die Erinnerungen an einen angeschossenen Kollegen kommen irgendwann wieder hoch.
Nicht selten mangelt es auch in den Chefetagen und Redaktionen an einem richtigen und wertschätzenden Umgang mit den Krisenreportern. Die Kollegen, die die Einsätze im Heimatland leiten, haben oft selbst keine Erfahrung damit und wissen auch nicht, wie sie die Kollegen, die sie ins Ausland schicken, darauf vorbereiten können. All dies kann zu falschen Entscheidungen mit schwerwiegenden Auswirkungen führen.
Opfer sensibel befragen
Zur Redakteursausbildung gehört es, zu lernen, wie man sprachmächtige Leute wie Politiker, Prominente oder Personen des öffentlichen Lebens interviewt. Doch Journalisten lernen in der Regel nicht, wie sie mit Menschen reden sollen, die etwas Traumatisches erlebt haben, die Opfer einer Gewalttat geworden sind, die im Krieg gefoltert oder vergewaltigt wurden oder hungern. Diese Menschen muss man anders als Politiker oder Prominente interviewen.
„Do no harm" – „keinen Schaden zufügen", heißt dabei die eiserne und oft einfache Regel. Die Seminare des Dart Center vermitteln, wie Journalisten einfühlsam mit von sexualisierter Gewalt betroffenen Frauen, mit Hinterbliebenen und mit Überlebenden umgehen sollen. Die Teilnehmer üben dies zum Beispiel in Rollenspielen, hören Vorträge zum Thema und erlernen Interviewtechniken für einen einfühlsamen Umgang mit Opfern. Die Seminarteilnehmer erfahren auch, dass traumatisierte Personen oftmals keine verlässliche Quelle sind, da ihre Wahrnehmung getrübt ist. Die Erlebnisse der Person, die man interviewt, können auch „ansteckend" wirken, wie es Trauma-Therapeutin und Medienausbilderin Fee Rojas formuliert. Das heißt, dass der Journalist mit dem Opfer mitleidet. Hilfsorganisationen und Opferverbände steuern ihr Wissen und ihre Erfahrungen für die Seminaristen des Dart Center bei, was zu einem hilfreichen gegenseitigen Austausch führt.
Journalisten müssen erlernen, was sie für den Berufsalltag stärkt: Das können Unterstützung der Kollegen und Strategien für die Selbstfürsorge sein, Gespräche mit Freunden, soziale Netzwerke und nicht zuletzt das Schreiben, das Berichten selbst. Journalisten, die ihre Erlebnisse in Beiträgen verarbeiten, laufen weniger Gefahr als beispielsweise Bildjournalisten oder Techniker, seelisch belastet zu sein. Damit sich Erinnerungen nicht verselbständigen, ist es wichtig, sie nicht zu verdrängen, sondern sie in das Leben zu integrieren.
Es ist auch wichtig, anzuerkennen, dass es normal ist, Albträume zu haben und sich Hilfe zu holen, wenn diese nach Wochen nicht aufhören. In Entwicklungs- und Krisenländern gibt es bislang nur vereinzelt Trainings- und Hilfsangebote für Journalisten von internationalen Organisationen. Das CPJ wie auch Reporter ohne Grenzen bieten in Not geratenen Journalisten und ihren Familien Unterstützung in Form von Asyl, Stipendien, medizinischer Versorgung und finanzieller Hilfe an. Die Organisationen geben auch Informationen etwa zu Sicherheitsvorkehrungen. Der Rory Peck Trust Fund oder das News Safety Institute führen auch Sicherheitstrainings durch. Das Internationale Rote Kreuz hat seit einigen Jahren eine Hotline und eine E-Mail-Adresse für in Not geratene Journalisten eingerichtet. Diese dient dazu, Hilfe bei Kidnapping zu organisieren, um etwa einen Kontakt mit den Entführern herzustellen oder im Falle eines plötzlichen Ereignisses medizinische Notversorgung zu organisieren.
Doch psychologische Unterstützung wird bislang nur wenig strukturiert und nachhaltig angeboten. Der haitianische Journalist Roosevelt Jean Francois entwickelte nach einem Workshop mit dem Dart Center und lokalen Trauma-Therapeuten ein „Peer support"-System für lokale Journalisten in Haiti, eine Hilfe zur Selbsthilfe. In Kambodscha fand 2007 ein Training für lokale Journalisten statt, das das Dart Center mitorganisierte. Es ging um die lang anhaltende juristische und gesellschaftliche Aufarbeitung des Terrorregimes der Roten Khmer, durch dessen Folgen ein Großteil der Bevölkerung noch immer traumatisiert ist. Dies betrifft auch viele Journalisten, die nicht selten Opfer in der eigenen Familie zu beklagen haben.
Während es für humanitäre Einsatzkräfte normal ist, sich auf Kriseneinsätze vorzubereiten, ist das bei Medienarbeitern noch nicht der Fall. Ein Grund dafür ist wohl auch, dass in Zeiten der Medienkrise in westlichen Ländern das Geld dazu fehlt. Dabei sollte daran nicht gespart werden. Denn es dient der Meinungs- und Pressefreiheit, wenn Journalisten unbeschadet und ausgewogen aus Kriegs- und Krisengebieten berichten können.
Der Artikel erschien in der Zeitschrift E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert und von ENGAGEMENT GLOBAL herausgegeben.