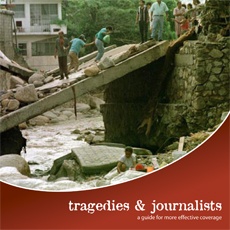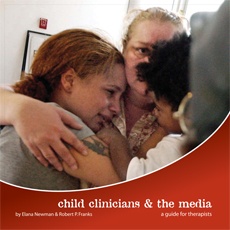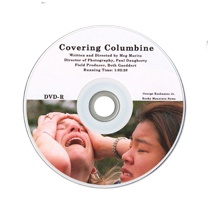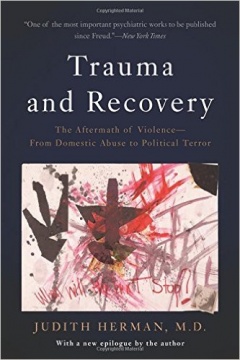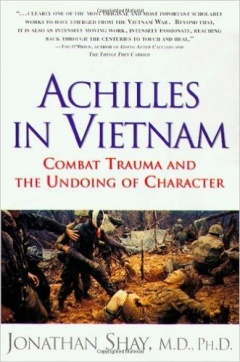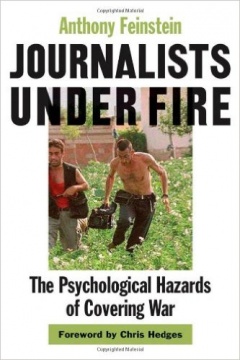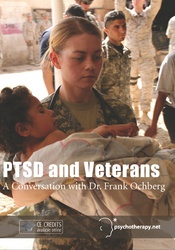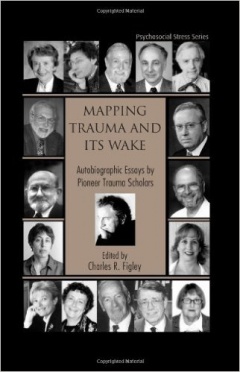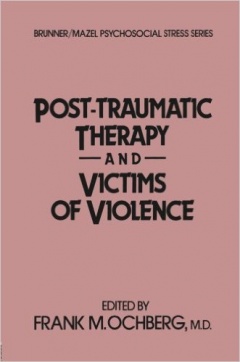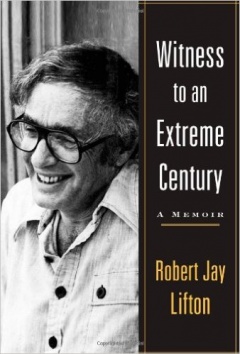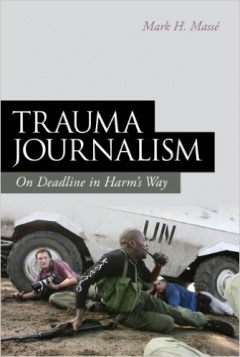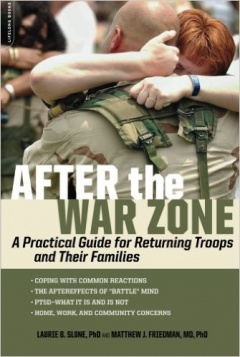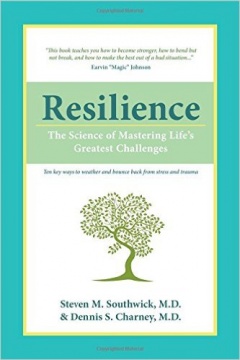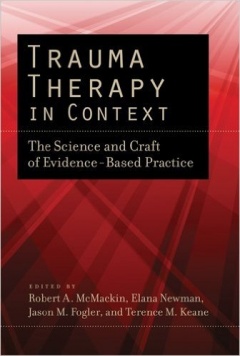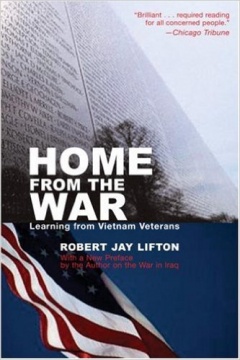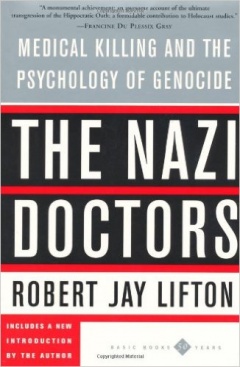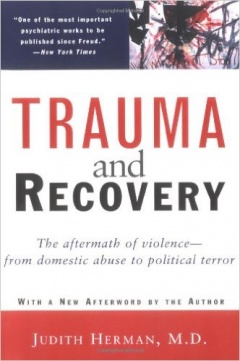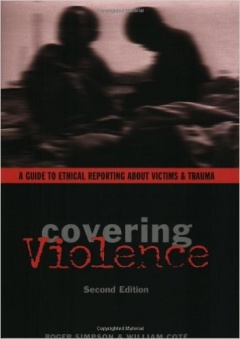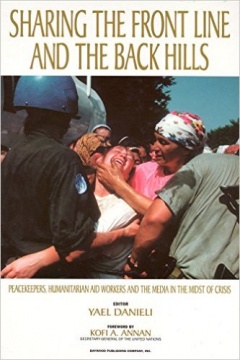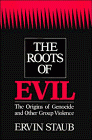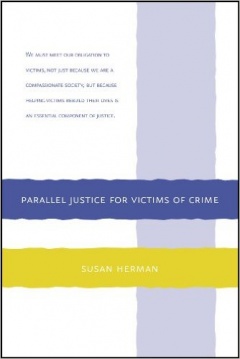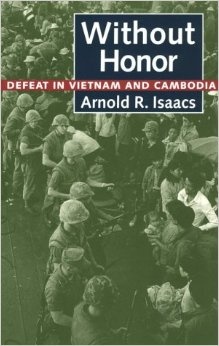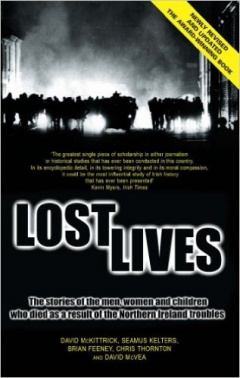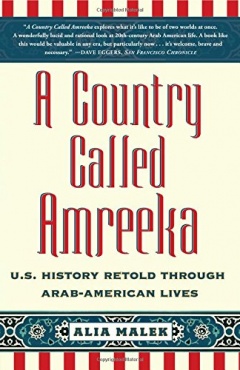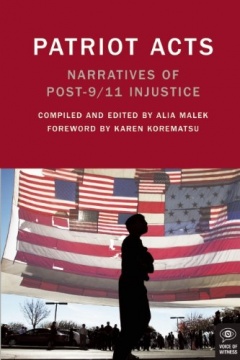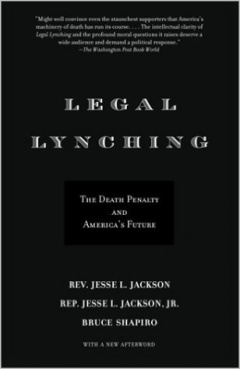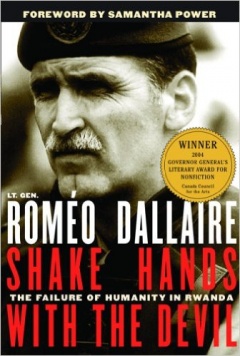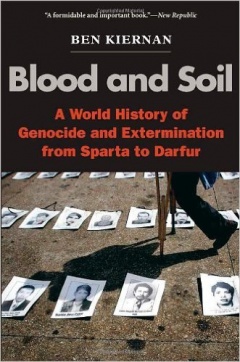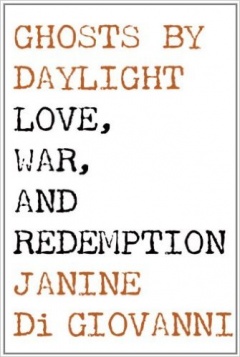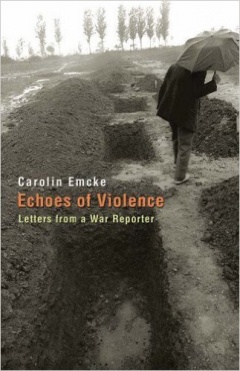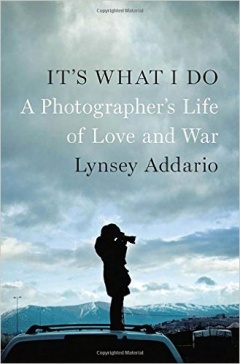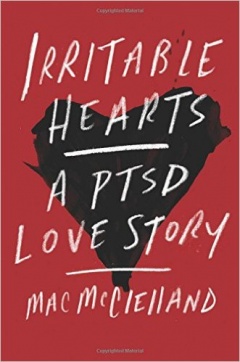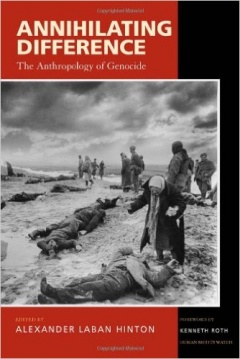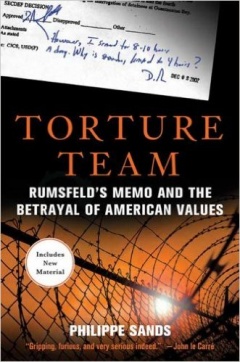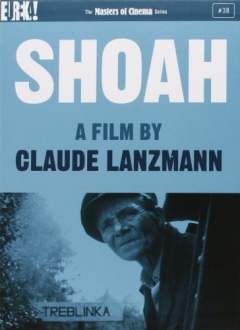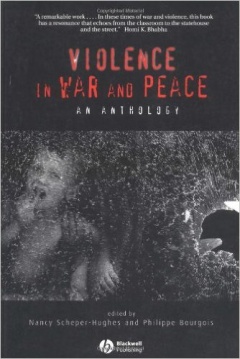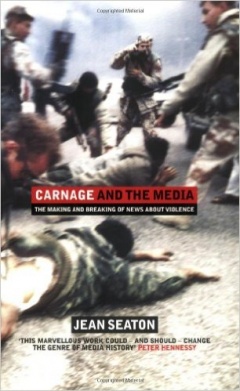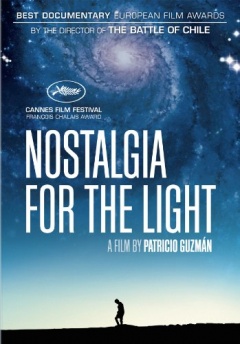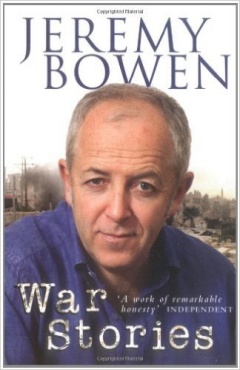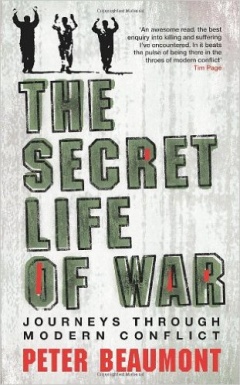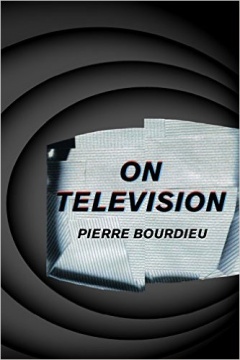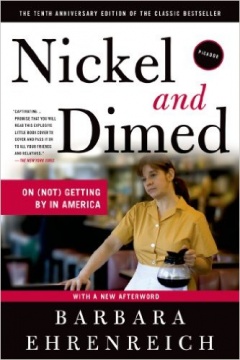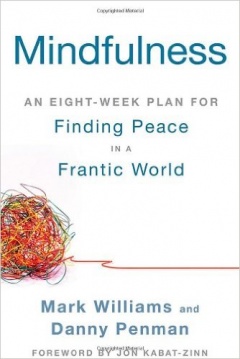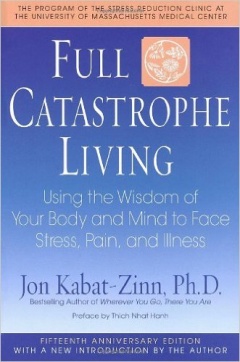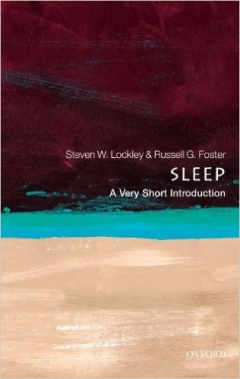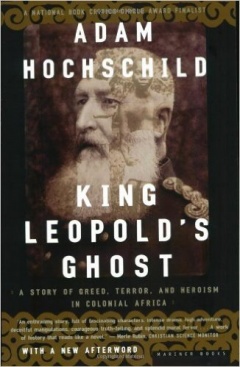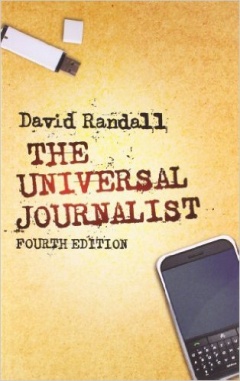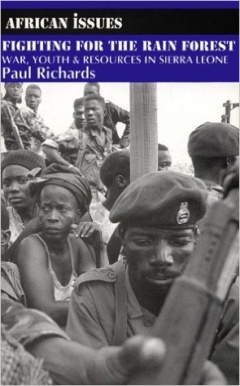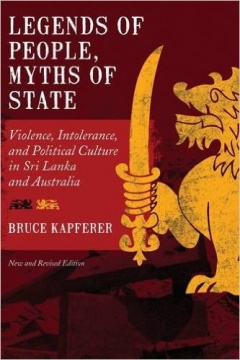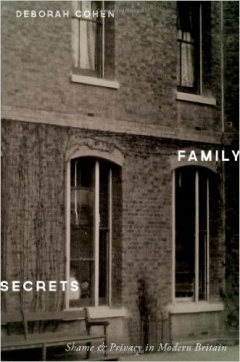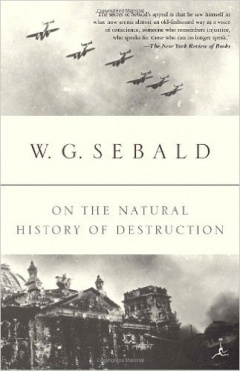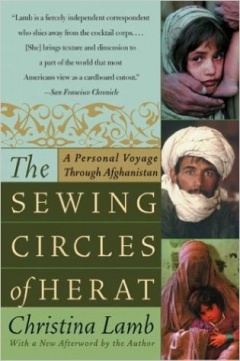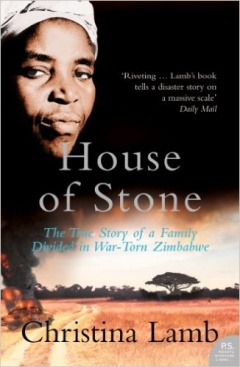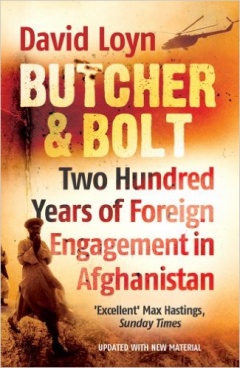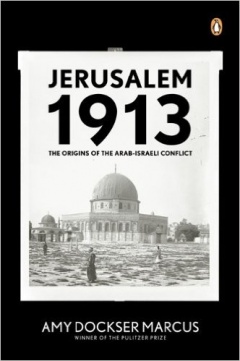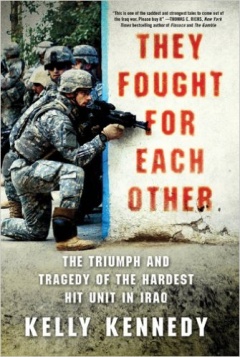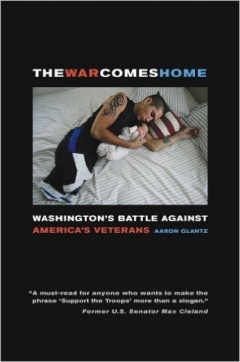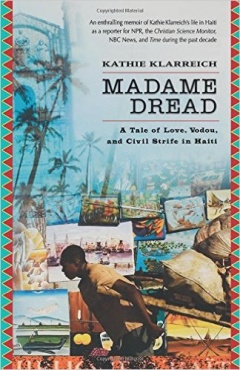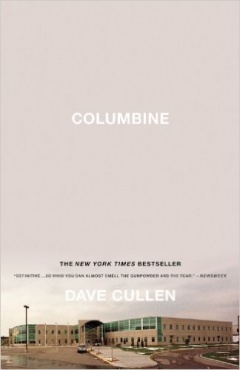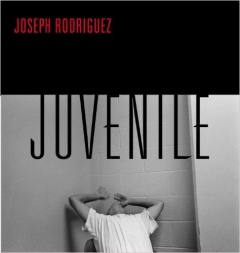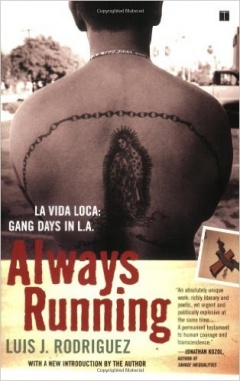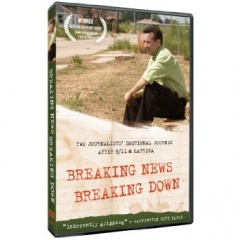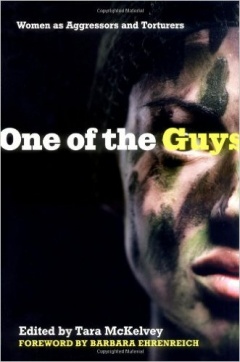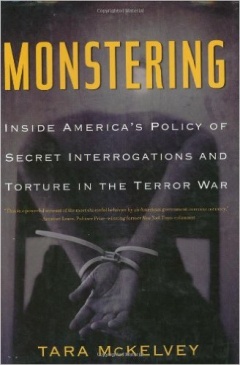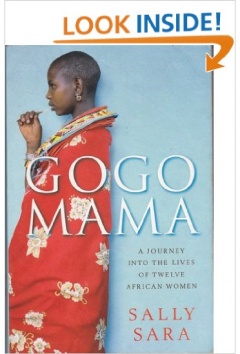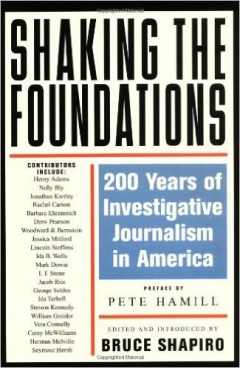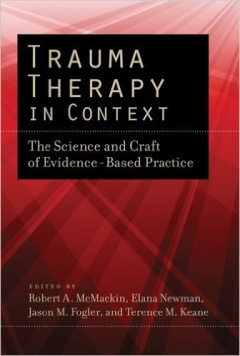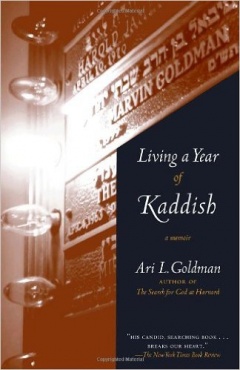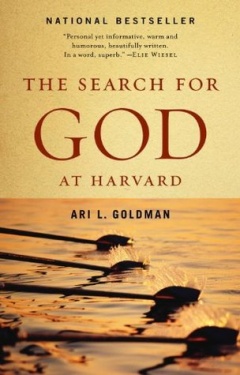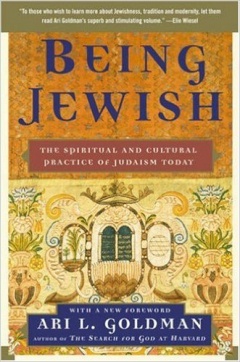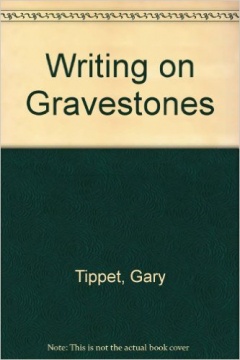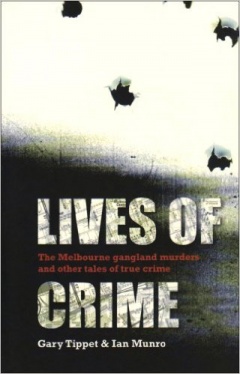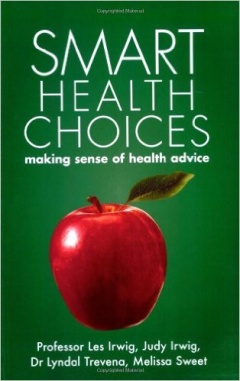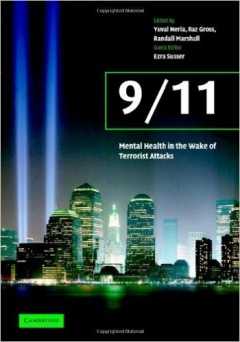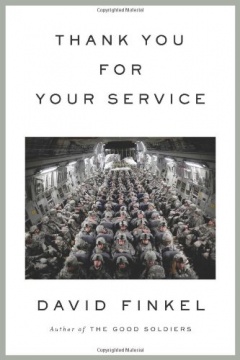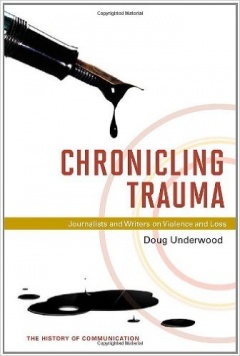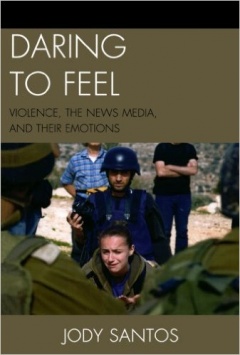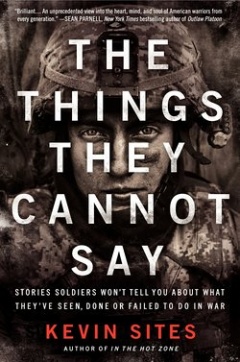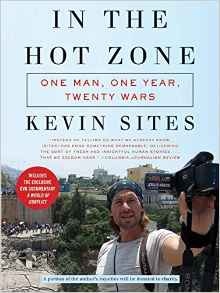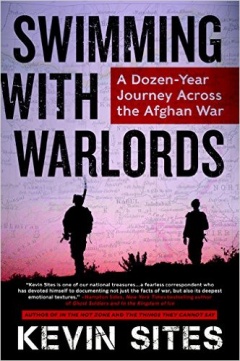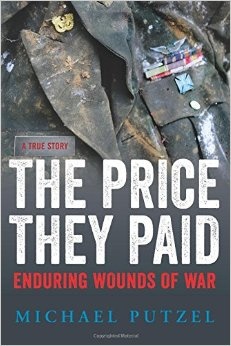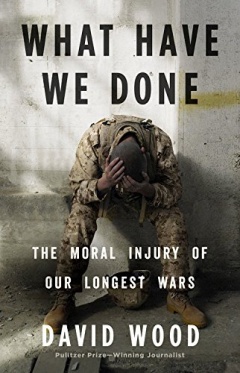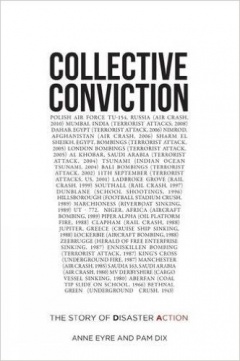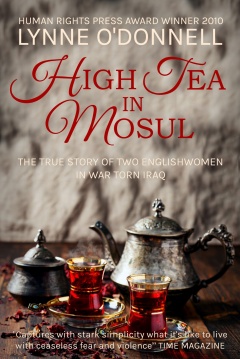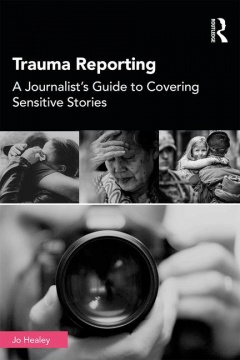Über die Verantwortung der Chefredakteure und Teammanagement
Katrin Hartig leitet den Bereich Journalistischer Hintergrund im mdr-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt. In diesem Interview mit Petra Tabeling gibt sie Einblicke in Ihre Arbeit in der Redaktion und den Umgang mit sensiblen Themen. Sie spricht über die Fürsorgepflicht für das Redaktionsteam und die Verantwortlichkeiten der leitenden Redakteure.
Welche Herausforderungen bestehen, wenn es um eine sensible Berichterstattung über belastende Ereignisse geht - für Ihre Redaktion, im Team, aber auch bei Ihnen als Führungskraft?
Unser Team besteht in erster Linie aus freien Mitarbeitern. Diese arbeiten zeitgleich für verschiedene Redaktionen. Um ein festes Team von Mitarbeitern zu haben, die jederzeit bei aktuellen Produktionen einspringen können, die unsere Formate kennen und gleichzeitig die „Denke und Philosophie“ unserer Redaktion mittragen, haben wir uns einen festen Redaktionsdienst geschaffen. Sozusagen eine „Eingreiftruppe“ für den Ernstfall – eine kleine, aber verlässliche Mannschaft. So können wir bei einem dramatischen Hochwasser, einem Zugunglück oder anderen Katastrophen sofort loslegen, wissend um die Spielregeln und Ansprüche unserer Redaktion und Sendungen. So haben wir an einem Katastrophentag früh um neun schon mal eine fertige Talk-Sendung kippen müssen. Wir hatten keine acht Stunden Zeit, um eine neue zu produzieren. Da muss man schon Vertrauen haben und eine journalistische Sprache sprechen, um zu wissen, wem man was zumuten kann. Für grundsätzliche Diskussionen ist dann nämlich keine Zeit mehr. Durch das geschaffene Kern-Team muss ich also auf niemanden zurück greifen, den ich nicht kenne.
Was sind Ihre journalistischen Ansprüche in Bezug auf Trauma-Berichterstattung, wenn es um schwere Ereignisse geht?
Es gibt ja Redaktionen, die legen größten Wert auf Tränen. Da herrscht die Denke: Wer nicht weint, taugt nicht. Das gilt nicht nur für die Privaten. Diese offen ausgesprochenen Anfragen erlebe ich häufig als ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Verwaisten Eltern und trauernden Geschwister in Deutschland. Da heißt es dann in den Anfragen: „Wir brauchen Leute, die vor der Kamera weinen. Andere brauchen wir nicht.“ Das gibt es bei uns in der Redaktion nicht. Wir sagen zum Kameramann in Vorbereitung auf Interviews mit Betroffenen, dass nicht auch noch auf die Tränen nah ran gezoomt wird. Gleichzeitig sind wir sehr vorsichtig, was „Frisch-Betroffene“ betrifft. Auch da gibt es ja bei uns im Bundesverband Anfragen von Redaktionen, in denen schon bewusst eingeschränkt wird und geschrieben wird: „Wir wollen aber Leute, bei denen das Erlebnis nicht länger als ein halbes Jahr zurück liegt.“
Natürlich habe ich da mit meinen langen Produktionen oft den Vorteil, nicht tagesaktuell agieren zu müssen. Aber selbst unter Zeitdruck ist es ja ein Signal, wenn man sagt: "Denken Sie noch einmal nach über unsere Anfrage, ich rufe sie in einer Stunde zurück."
Wichtig ist mir in unserer Redaktion immer die Frage: "Was ist Ziel unseres Interviews?" Dieses Ziel muss dann auch klar kommuniziert werden. Es hilft auch den Betroffenen. Das heißt, eine Offenheit darüber, was möglich ist unsererseits und was vielleicht die Erwartungshaltung des Betroffenen ist, ist uns wichtig.
Sonst ist die Enttäuschung groß und es bleibt das Gefühl, „benutzt“ worden zu sein. Manchmal bieten wir auch – speziell für unseren Polittalk – an, Begleitpersonen mitzubringen. Das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, hilft aber den Gästen oft.
Können Sie ein Beispiel nennen und die Problematik, mit der Sie konfrontiert waren?
An eine Sendung erinnere ich mich besonders intensiv. In Hordorf in Sachsen-Anhalt war ein Zug verunglückt (Anmerkung d. Redaktion: am 29.01. 2011 starben dort zehn Menschen). Wir haben aus diesem Anlass eine komplett geplante Sendung „gekippt“. Allerdings konnten wir uns noch die Zeit nehmen, eine Nacht darüber zu schlafen, nicht gleich dem ersten Impuls zu folgen und wild drauf los zu agieren. Wir stellten uns schon die Frage: Springen wir da jetzt einfach auf ein Thema auf? Oder was können und wollen wir mit unserem Polittalk leisten? Andererseits: Können wir ein Unglück solchen Ausmaßes im Sendegebiet ignorieren? Welche Frage können und wollen wir mit der Sendung beantworten? Die Versuchung an solchen Tagen ist natürlich groß, sofort und zuerst Betroffene einzuladen.
Wir haben im Funkhaus noch zwei aktuelle Sendungen, die an diesem Tag vor uns liefen. Die Kollegen hatten live in den Sendungen zwei Vertreter der Rettungskräfte zu ihren Erlebnissen befragt. Inzwischen waren die beiden Männer aber seit fast 24 Stunden auf den Beinen. Sie hatten die Toten gesehen, bergen müssen, manchmal nur noch Teile von Menschen. Es war eigentlich einfach, die beiden anzusprechen und auch noch in den Talk zwei Stunden später einzuladen. Sie standen etwas verloren im Flur des Funkhauses. Es hing eine nicht ausgesprochene Erwartung von einigen Kollegen in der Luft, die beiden selbstverständlich auch in unseren Talk einzuladen. Und alle gingen davon aus, dass die beiden Männer ja wohl selbst über eine solche Anfrage entscheiden können. Aber genau das war der springende Punkt. Konnten sie das noch? Um das zu klären, bin ich persönlich zu ihnen gegangen. Ich wollte mir selbst ein Bild machen. Und tatsächlich gaben sie bereitwillig Antworten. Aber eindeutig war auch, dass sie unter Schock standen, ihre Stimme und Hände zitterten. Der Blick war leer. Sie waren inzwischen gar nicht mehr in der Lage, für sich zu sorgen und zu entscheiden. Ein halbes Jahr später erfuhr ich von der zuständigen Krisenintervention, dass das offensichtlich eine richtige Wahrnehmung war. Und ehrlich gesagt, war ich sehr froh, dass wir damals in der Redaktion darauf verzichtet haben, sie auch noch durch unsere Sendung zu „schleifen“.
Interessant ist ja, dass fast alle Kollegen wissen, dass man alkoholisierte Menschen nicht interviewt. Aber die wenigsten wissen, wie man mit traumatisierten Menschen umgeht. Leider kennen in meinem Umfeld noch zu wenige Kollegen die Angebote des Dart Centre für Trauma und Journalismus. Gerade in den Workshops erfahren ja Kollegen dann, dass jemand, der gerade mit dir redet, nicht unbedingt wahrnimmt, was er da tut. Da besteht noch großer Aufklärungsbedarf.
Erwarten Sie eine solche Sensibilität von Ihren Mitarbeitern?
Das kann ich nicht erwarten, da es nicht flächendeckend Teil der journalistischen Ausbildung ist. Und Fortbildungen zu dem Thema haben die wenigsten besucht. Da ist noch Nachholbedarf. Aber es bewegt sich etwas. Winnenden, Hordorf, Erfurt und andere Katastrophen haben uns in den letzten Jahren sensibler gemacht. Wir haben inzwischen ja auch eine Gruppe, die sich mit Rechtsextremismus beschäftigt, eine Art Task Force. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch zum Thema Trauma eine geschulte Gruppe Mitarbeiter geben kann. Aber ich kann es von Führungskräften erwarten.
Es gibt Situationen, die wir nicht ändern können, sie passieren. Aber vor allem Führungskräfte können lernen, damit umzugehen. Und es ist aus meiner Sicht ihre Pflicht. Auch aus der Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern heraus. Wenn ich sehe, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn mit traumatisierten Lokführern umgeht, da können andere Unternehmen - auch Medienunternehmen - noch viel lernen. Bei der Bahn gibt es ein ganzes Betreuungskonzept und eine Gesundheitsmanagerin, die sich damit beschäftigt.
Letztendlich stehe ich als Redaktionsleiterin im Abspann ja nicht ohne Grund als letzte mit meinem Namen. Und als Führungskraft bin ich verantwortlich für redaktionelle Qualitätsstandards.
Was würden Sie denn als guten Umgang sehen für ein Team? Wie betreiben Sie Für- und Nachsorge für die Mitarbeiter?
Es ist immer die Frage, wie im Team überhaupt kommuniziert wird. Wenn die Hauptkommunikation aus Druck besteht, vor allem der Quote zuliebe, dann ist das die Überschrift, unter der agiert wird. Natürlich spielt Quote bei uns eine wichtige Rolle. Auch wir wollen in erster Linie gute Sendungen produzieren, die möglichst viele Zuschauer sehen wollen. Aber die Frage ist ja, wie ein Redaktionsleiter das kommuniziert. Wenn das um jeden Preis geschehen soll, wird jeder alles dafür tun, jemanden vor die Kamera zu bekommen, koste es, was es wolle. Wichtig sind eine entsprechende interne Kommunikation und Vertrauen. Ich weiß, dass ich bei bestimmten Kollegen in meinem Team im Vorfeld einer Berichterstattung gar nicht mehr über bestimmte Dinge reden müsste, weil ich sie bereits in schwierigen Situationen erlebt habe. Da muss ich z.B. das Thema Rücksicht auf Betroffene nicht weiter kommunizieren.
Vielleicht ein Beispiel zum Thema Nachsorge für Mitarbeiter: Wir hatten für ein Magazin einen Unfall nachgestellt. Die Zahl junger Verkehrstoter war dramatisch gestiegen, das wollten wir thematisieren. Und auch darüber berichten, wie Eltern und Freunde danach weiter leben. Gemeinsam mit der Polizei stellten wir den Unfall nach. Vier Jugendliche waren in diesen Unfall verwickelt. Zwei starben, zwei überlebten. Im Vorfeld hatte die Polizei den Kontakt zu allen Müttern gesucht, auch wegen der Persönlichkeitsrechte. Die Vorbereitungen dauerten einige Monate.
Unsere Autorin führte dann lange Vorgespräche. Zunächst telefonisch, dann persönlich und noch ohne Kamera. Dann kam es zum Dreh. Am Ort des Geschehens, mit Schauspielern, mit Rettungskräften und der Polizei. Alle Beteilgiten hatten ausreichend Zeit, sich vorzubereiten. Dann aber war die Autorin schockiert, dass die Mütter darauf bestanden, bei dem Nachstellen des Unfalls persönlich anwesend zu sein. Damit hatte sie überhaupt nicht gerechnet. Sie hat aus einem Impuls heraus versucht, sie davor zu schützen, und wollte es ihnen ausreden. Sie kam aufgelöst von dem langen und intensiven Dreh zurück. Sie beschäftigte die Frage: Warum tun diese Mütter sich das an? Hätte ich das als Autorin verhindern müssen? Bin ich dafür verantwortlich?
Wie haben Sie das aufgefangen?
Da waren lange Gespräche mit der Autorin und dem Kameramann unmittelbar nach dem Dreh nötig, auch um zu klären, warum die Mütter dabei sein wollten. Als der Beitrag fertig war, haben wir noch einmal miteinander gesprochen und nach der Ausstrahlung hat die Autorin noch einmal zu allen Beteiligten Kontakt aufgenommen. Ich glaube, das Gespräch nach dem Dreh war zwar sehr wichtig, aber viel wichtiger war der Austausch mit den Protagonisten, was der Film mit ihnen gemacht hat. Da konnte sie für sich selbst spüren, ob sie alles richtig gemacht hat. So erfuhr sie, dass durch die Dreharbeiten die Betroffenen nach zehn Jahren erstmals miteinander ins Gespräch kamen. Befragt nach dem, was die Interviews und Dreharbeiten bei einer der Überlebenden, inzwischen einer junge Ärztin, auslösten, antworte die Autorin, dass sie die geführten Interviews auch als Chance der Aufarbeitung sah: „Die Gespräche, die durch diese Interviews entstanden, lösten vieles auf. Sie führten zu Aussprachen mit dem noch überlebenden jungen Mann, und zu Antworten auf Fragen, die kurz nach dem Unfall noch nicht geklärt werden konnten.“
Wie wichtig sind die Gespräche mit dem Team und den Mitarbeitern? Und wie gehen Sie da vor?
Wir haben eine bestimmte Feedbackkultur: Am Tag nach der Ausstrahlung eines Filmes gibt es immer ein Abschlussgespräch mit dem Autor. Das haben wir ritualisiert, auch wenn wir dann oft schon an den nächsten Geschichten arbeiten. Es ist wichtig und wird im Kalender eingetragen, sonst rutscht es uns mit all den anderen Terminen durch. Wenn es uns gelingt, sind auch die Kameraleute und die Cutter dabei, also alle Beteiligten. Das nimmt alle in die Verantwortung, noch einmal zurück zu schauen und eventuell fürs nächste Mal Probleme anzusprechen und zu lösen. Und es ist nicht nur eine Art Angebot unter dem Motto, "wenn Du magst, machen wir das…" Da sehe ich uns als Führungskräfte in der Pflicht.
Ich finde es problematisch, wenn nach traumatischen Erlebnissen nur ein Satz fällt wie dieser: „Wenn du Hilfe brauchst, dann reden wir gerne drüber.“ Ich denke, dass viele Kollegen dann befürchten, dass es als Schwäche ausgelegt wird. Weil viele dann Angst haben, das wäre dann nicht mehr so professionell nach dem Motto: „Oh Gott, ich brauche ja Hilfe“. Wenn ein solches Gespräch aber Standard im Redaktionsalltag ist, gehört es wie selbstverständlich in den Maßnahmenkatalog zur Qualitätssicherung einer Redaktion. So ähnlich wie die obligatorische Sendungskritik.
Bei all dem ist jeder für sich selbst verantwortlich. Da können wir uns etwas vom Hospizbereich abgucken. Da ist Supervision Pflicht. Und auch wir Journalisten müssen gut für uns sorgen. Wenn man merkt, meine Redaktionsleitung ist nicht wirklich sensibel für diese Fragen, dann ist es vielleicht das Kamerateam, mit dem man nach einem Dreh ins Gespräch kommt, oder Kollegen.